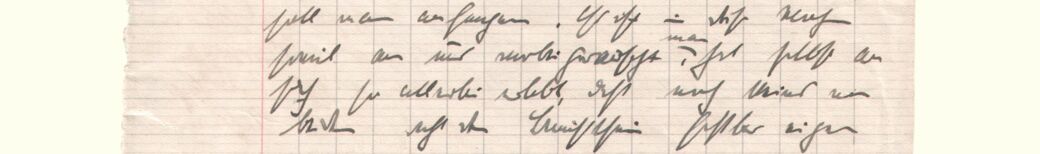Rückblicke
Wulf fährt mich nach Leeste die Vorgeschichte dieser Zeilen
Ich hatte die Medower besucht, am Tag vorher in Greifswald mich etwas angestrengt. Gerade fertig mit Ott nach Anklam zu fahren, überfiel mich dies „Unwohlsein“, so dass wir nicht ins Museum, sondern zum Krankenhaus fuhren, wo nach den üblichen Untersuchungen, der Befund einen „angina pectoris“ Anfall vermuten ließ. Nach Hause mit der Bahn! Auf keinen Fall, sagte die Ärztin, am Besten ist es, es fährt sie jemand mit dem Auto zurück!
Nun es half nichts, ich musste schon einwilligen und dann erschien Wulf mit Robert, seinem großen (17) Sohn als „Copilot“ für die Rückfahrt.
Wir saßen bequem, auch Wulf, der sich immer nur im Trabi recht unbequem hinter das Lenkrad quetschen konnte. Es war mir nun sehr recht und ich war dankbar, dass Wulf sich bereit erklärt hatte. Recht war mir auch, dass ich die Gelegenheit wahrnehmen konnte, einmal mit meinem Enkelsohn zu plaudern, er saß schräg hinter mir. Seit einiger Zeit machte er den Eltern etwas Kummer. Die Schule wollte ihm nicht schmecken, auch sympathisierte er mit den „Skinheads“ jedenfalls im äußeren Haarschnitt, Stiefel usw. Sicher nichts Besonderes für sein Alter, aber ... .
Nun, vielleicht nimmt er von seinem Großvater einen Rat an? Robert, Du bist jetzt auf dem Gymnasium in T. Wie läuft es den da so? Wenn ich an meine Gymnasialzeit zurückdenke, habe ich nicht gerade die besten Erinnerungen, ein groß' Teil unsrer Lehrer damals waren ganz schlechte Pädagogen, heute mag es ja besser sein, oder? Na, ich merke, Dir ist die Schule auch kein ungetrübtes Vergnügen. Aber Robert, dat helpt ja nich, man möt dörch! Man möchte ja etwas werden, etwas tun, damit die Welt besser wird. Wir Alten haben bei so manchem wissenschaftlichen und technischen Fortschritt doch auf entscheidenden Gebieten versagt. Aber, wenn man etwas nun besser machen will, dann muss man zunächst einmal gewisse Spielregeln anerkennen, d.h. die Schule annehmen, und ganz banal gesagt, den Schein anstreben der weiterhilft, also Abi u.a. Denk mal: Chrischi ist ja Ärztin, sie möchte ihren Facharzt bei dem Arzt machen, der neue Methoden anwendet, das hat sie im Praktikum bei ihm schon anwenden dürfen, aber sie wäre nicht einmal auf die Bewerberliste gekommen, wenn sie auf die Frage, ob sie ihren Dr. hätte, mit nein hätte antworten müssen. Gewiss vermittelt eine Doktorarbeit Spezialkenntnisse, aber ein besserer Arzt wird man kaum durch die Promotion. Und noch ein Gesichtspunkt! Und noch einer aus unsrer Familie hat einmal gesagt: als Facharbeiter verdiene ich später meist mehr und habe weniger Ärger, aber ich möchte mir doch nicht von einem dumm kommen lassen müssen, nur weil der sich „Ingenieur“ nennen darf; deshalb will ich nun doch studieren, zumal ich mir den Studienplatz sauer genug verdient habe.
Also, überleg mal und sag es dir immer wieder einmal, ob es sich nicht lohnt, die Schule zu ertragen! Es gibt ja auch Lehrer und Fächer die man mag, Lehrer, die junge Menschen verstehen und die einem dann auch etwas bedeuten. So war es zu meiner Zeit auch schon, Gott sei Dank! Hier hielt ich erst einmal inne und versuchte, festzustellen, wo wir uns inzwischen befanden. Güstrow kann hier nicht weit sein, dachte und sagte ich. Den Umweg dahin zu machen, lohnte sich jedoch sicher nicht, denn wir würden ihn kaum antreffen; das ist ja die Kehrseite bei Leuten, die sich engagieren, so wie er. Er war immer begeistert von den Aufgaben, die sich stellten, hatte es auch verkraftet, dass er nicht studieren durfte, was er wollte. Das er überhaupt ohne große Widerstände studieren konnte, verdankte er - ich weiß nicht, ob du es weißt - der an sich traurigen Tatsache, dass sein Vater noch ohne einen Beruf zuhaben gefallen war, so dass der Sohn als „Arbeiterkind“ angesehen wurde.
Übrigens waren Axel und Lutz mal wieder bei euch? Sie haben die Schule auch durchgestanden - Ja doch die waren mal da - Doch was nun, war es richtig, was ich gesagt habe, oder auch, dass ich überhaupt dies Gespräch versucht hatte? Schon oft hatte ich das Gefühl, die Jüngeren wollen uns Alte gar nicht hören, doch, siehe da, der Enkelsohn wollte noch hören, wollte fragen.
Von mir sollen nun auch einige Daten folgen. Erinnerungen an meine frühe Kindheit habe ich kaum. Auch dass ich in Breslau als Fünfjähriger mit großer Ausdauer am Fenster gestanden hätte, um die vorbeikommenden Pferde zu beobachten und zu zeichnen, weiß ich eigentlich mehr durch späteres erzählen meiner Mutter. Dass mir dies „Kunststudium“ später in Anklam auf dem Gymnasium einen kleinen Triumph einbrachte, habe ich allerdings nicht vergessen. Es war wohl in der Quinta als ich in der Pause auf die Wandtafel ganz groß ein aufgezäumtes und geschirrtes Pferd mit Kreide gezeichnet hatte. Es fand den Beifall meiner Klassengefährten, sodass schließlich ein Abwischen verhindert wurde ehe nicht das ganze Lehrerkollegium es auch besichtigt hatte. Logischerweise hätte das nun ja zu einem „sehr gut“ auf dem Zeugnis führen sollen, aber weit gefehlt. In der Folge erscheint sogar noch das „genügend“ bis in die Oberklasse hinein, bis ich, es war wohl in der Obersekunda, dem Zeichenlehrer zu sagen wagte, ich hätte doch schon eine 2 gehabt. Er schickte mich darauf in die Aula mit dem Auftrag, ich solle zwei Stühle, mit den Sitzen aufeinander gesetzt abzeichnen, wenn ich das fertig brächte, bekäme ich sogar eine „1“. Und so wurde es und so blieb es. Doch auch auf anderen Gebieten sind mir keine schönen Erinnerungen an die Schule geblieben. Nachdem ich schon lange Privatunterricht auf Vorschlag der Lehrer in Latein und Mathematik erteilt hatte, stellte sich doch kein „gut“ auf dem eigenen Zeugnis ein. Man sagte mir ich wäre nicht lange genug auf dem aufstrebenden Aste. Doch es gab auch Lehrer, die mich verstanden. Dr. Eichhoff, der uns Pfadfinder an der Schule unterstützte, der mich zum Hilfsbibliothekar an der Schule machte, Dr. Bruinier, der meine Freude am Geschichtlichen stärkte, der Zeichenlehrer Godow, der mich fast kollegial behandelte, mich schließlich von Zeichenunterricht dispensierte und mich für würdig erachtete, an einem Lehrgang für Porträtzeichnen teilzunehmen. Doch die Schule war nur ein Lebensbereich, wie es bei Kindern wohl allgemein so ist. Der zweite war die Gruppe der Deutschen Freischar, die sich schließlich aus der Wandervogelgruppe entwickelt hatte. Hier waren es Molli, Dr. Herbert Möller, Philologe und Kunsthistoriker und besonders Hermann Bollnow, der spätere Historiker und Professor, aber auch Fritz Küger, der Pate von Ottfried, die als etwas ältere mir sehr viel bedeuteten. Das Zuhause war natürlich ein weiterer sehr wichtiger Bereich, Hausbau, Garten und Werkstatt waren mit Aufgaben und Möglichkeiten da. Was ich einmal werden sollte, blieb lange offen. Die einen rieten mir zum Kunststudium, die anderen zur Philologie, aber wovon studieren? Die wirtschaftliche Lage zu Hause war sehr angespannt, so war es für uns Jungens, die wir durchaus Lust und Geschick zum Technischen hatten, von vornherein ausgemacht, bei aller Liebe und Achtung vor dem Beruf des Vaters, nur nicht auch solche Quälerei. Kunst schien mir deshalb ungeeignet, weil ich wenig Lust zum Lehrer hatte (Zeichenlehrer) und weil Zeichnen und Malen mir ja Spaß machte also keine Arbeit war. Kunstgeschichte und Geschichte allerdings war etwas, was mich reizte. Nun aber war wie es sich ja im jugendlichen Alter normalerweise ergibt, besonders nach dem sehr guten Konfirmandenunterricht bei Dr. Fritsch die Frage nach Gott und Glaube akut, ja brennend geworden. So hatte ich freie Sonntage, an denen ich nicht mit der Freischargruppe unterwegs war, dazu genutzt als Kindergottesdiensthelfer zu fungieren und den Gottesdienst - immer voller Fragen, die dann oft genug doch keine Antwort fanden - zu besuchen. Auch besuchte ich ziemlich regelmäßig die Abende des Jungmännervereins - Junge Gemeinde - , die Pastor Prost später in Greifswald mit Geschick und Liebe leitete. Kurzum, die Glaubensfrage war eine recht vordergründige geworden. Auch schien es uns - für Fritz Krüger und Jochen Fuchs- galt wohl das Gleiche - kaum etwas Wichtigeres zu geben, als den Menschen unseres Landes zumal in der damaligen krisenhaften und unsicheren Zeit, Helfer zum Glauben zu werden. So entschied ich mich für das Theologiestudium auf die Gefahr hin, es abbrechen zu müssen, wenn ich dabei zu keiner Festigung des Glaubens käme. Das Risiko schien mir dabei gering, weil diese Frage nun einmal doch geklärt werden musste und weil das Studium selbst realisierbar erschien. Ich konnte täglich nach Greifswald fahren, Privatstunden erteilen. Fleißprüfungen und ein kleines Stipendium von Seiten der Kirche von mal zu mal gegeben, konnten weiterhelfen. So begann ich nach dem Abitur im Frühjahr 1930 in Greifswald das Studium der Theologie. Rückblickend war es eine schöne Zeit, auch wenn die äußeren Bedingungen oft recht hart waren. In der Hochschulgilde St. Georg, einer studentischen Verbindung der Jugendbewegung, fand ich gute Freunde und einen Kreis junger Menschen, die, zwar sehr unterschiedlich nach Konfession und politischer Neigung, eins waren in dem Bestreben, zu fragen und zu suchen nach einem Leben der Verantwortung. Das traditionelle Verbindungswesen mit Kneipe und Mensur lehnten wir ab. Fahrten, Abende, auf denen wir sangen und diskutierten, uns Professoren und Dozenten einluden, auch weiterhin in unseren Jugendgruppen aktiv waren, füllten unsere Freizeit aus. Da wir den verschiedensten Fakultäten angehörten, hatten wir Teil an einer gewissen universitas literarum. Die Theologische Fakultät Greifswald hatte damals einen guten Ruf, Deißner und Jeremias, Hermann und Baumgärtel waren meine Lehrer, sie halfen mir auch, für ein Semester (1932) nach Königsberg zu gehen, wo ich im Lutherischen Konvikt, dem Iwand vorstand, meinen Mittagstisch hatte. Bei Schniewind war ich oft zum offenen Abend. Hier war auch von Arseniew, der orthodoxe Theologe, Altersfreund der Gilde. So war diese Zeit voller Anregungen, aber auch voll erschütternder Einblicke in die soziale und politische Situation der Zeit. Als ich frühmorgens und übermüdet, also wohl nicht sehr frisch aussehend, den Bahnhof in Königsberg verließ, sprachen mich als erste bettelnde Kinder an: Erbarmung, Herr, gebn se mir n Pfannich (Pfennig). Und in der Richardstraße 5, wo ich eine billige Bude (2 mal 3,5m) gefunden hatte, fand ich in meinen Wirtsleuten arme verbitterte Menschen vor, er arbeitslos und krank, die alle Hoffnung auf Hitler setzten, der ja dann auch noch im gleichen Winter zu einer Großkundgebung in den Messhallen erschien. Ich ging aber trotz Zureden nicht hin, mir war der Mann unheimlich.
Nach Greifswald zurückgekehrt musste ich dann doch noch das Hemd der SA anziehen, als korporativ, ohne, dass wir gefragt wurden, alle studentischen Verbindungen in die SA überführt wurden. Da ich mich aber zum Frühjahr 1934, zum 1. Examen, gemeldet hatte, wurde es zunächst für mich nicht weiter akut. Auch deshalb nicht, weil ich nach weitgehender Fertigstellung der schriftlichen Arbeit erkrankte (Nervenzusammenbruch).
Obwohl ich mich auf die mündliche Prüfung nicht mehr vorbereiten konnte, zog ich die Meldung zum Examen nicht zurück. Ich bestand, musste mich in Dogmatik und aber einer Nachprüfung unterziehen, was eigentlich mehr Pech war, weil ich in Dogmatik von Koepp geprüft wurde, den ich nie gehört hatte. Meine praktische Tätigkeit begann nun damit, dass ich noch zur Erholung gleichsam nach Leopoldshagen als Prädikant geschickt wurde, d.h. ich sollte dort sonntäglich einmal predigen, Kindergottesdienst halten, Konfirmandenunterricht erteilen, taufen, trauen und beerdigen. Weil der Sommer schön war, die Menschen nett zu mir, weil ich plattdeutsch konnte, ich mit Kindern und auch jungen Männern guten Kontakt bekam, erholte ich mich bald doch soweit, dass ich selbst die anstrengendsten Konfirmationsfeiern meiner ersten 14 Konfirmanden heil überstand. Ich hatte nämlich versprochen, sie alle am Konfirmationstag zu besuchen. Zu dieser Zeit bahnte sich etwas, von dem an, was man später Kirchenkampf nannte. Immer wieder einmal, sagte mir der Landgendarm, er erwartete mich dann vor der Kirche, er wäre einmal leider nicht privat diesmal im Gottesdienst, er solle aufpassen. Die Bekennende Kirche unter Niemöller hatte Stellung bezogen; auch von den Deutschen Christen Hossenfeldscher Richtung hatte schon etwas bis in unser Land hier oben ausgestrahlt. Die meisten Deutschen Christen bei uns aber waren durchaus bibel- und bekenntnistreue Leute, die allerdings damals noch dem Nationalsozialismus Gutes auch für die Kirche zutrauten. Niemöller aber war vielen zu radikal und seine Anhänger hier bei uns zu konservativ und reaktionär. Im Konsistorium in Stettin aber war keine der radikalen Richtungen bestimmend. Der eine der geistlichen Leiter, Boeters, gehörte zur Bekennenden Kirche, der andere, Prof. D. Laag, war deutscher Christ. Das Kirchenregiment war allerdings - wenn auch noch einigermaßen intakt - doch nicht mehr ein von allen und in allem anerkanntes. Die Gefahr eines Zerbrechens bestand wohl auch bei uns. Das dürfte nun - so sehe ich es heute - dazu geführt haben, dass Männer wie von Schewen, der spätere 1. Bischof unserer Pommerschen Kirche, zu einer Besinnung auf unser Lutherisches Bekenntnis und zugleich zu einer Gemeinschaft der Nichtradikalen aufrief. Man nannte das auch Bund der Mitte oder Wittembergerbund. Die meisten der Anklamer Pastoren gehörten dazu. Unter den Grundsatzerklärungen und Aufrufen findet man auch meinen Namen. Im Herbst 1935 bezog ich dann das Predigerseminar in Stettin, das in Lic. Nordmann einen fähigen Leiter hatte. Wir waren wahrscheinlich auch eine sehr dankbare, wenn auch kritische Belegschaft, hatten doch die meisten von uns nicht nur als Vikare, sondern als selbstständige Prädikanten schon Dienst getan. Der Mangel an Pastoren war damals groß. Das, was uns neben Theologie an Praxis in Verwaltungsfragen, Kirchenrecht, Kirchenmusik (Flügelhornblasen) geboten wurde, nahmen wir als praxisbezogen gern an. Unsere Predigten, die dann am nächsten Tag gebührend kritisiert wurden, hielten wir im Rahmen der Wochengottesdienste in der Nordkapelle der Jakobikirche, die Katechesen und Konfirmandenstunden in der nächsten Pfarrgemeinde. Dadurch, dass das Predigerseminar im Anstaltsgelände der Krückenmühler Anstalten lag, hatten wir auch Kontakt und Einblick in die Anstaltsgemeinde und ihre diakonische Arbeit. Sonntags aber waren wir - wie ich es in Erinnerung habe - fast immer im Gottesdienst bei Rendtorf. Hier traf sich die bekennende Gemeinde Stettins in überfüllten Gottesdiensten, der alte Feldmarschall Mackensen war sehr oft mit seinen Angehörigen in voller Uniform dabei, wie man wohl hörte, um zu dokumentieren, dass Christsein und rechter Mann sein wohl zueinander passe nach dem Worte E. M. Arndts: Wer ist ein Mann, der beten kann und Gott, dem Herrn vertraut.
Da das Predigerseminar nur ein halbes Jahr dauerte, wurden wir bis zum 2. Examen (Meldung erst 2 Jahre nach dem ersten möglich) erneut in vakante Pfarrstellen als Prädikanten eingewiesen. Mir traute man zu, dass ich mit Superintendent Russe klar käme, dem nacheinander Vikare weggelaufen waren. Er war ein gefürchteter cholerischer Mann. Etwas unpädagogisch sagte man mir auf dem Konsistorium, ich dürfe mir nichts gefallen lassen, sondern soll notfalls dem Herrn Superintendenten erklären, ich wäre nicht sein Vikar, sondern zur Verwaltung der 2. Pfarrstelle nach Jakobshagen entsandt worden. Bis auf eine kleine Auseinandersetzung ging dann aber alles gut. Hier lernte ich Hinterpommern noch in ungebrochener Kirchlichkeit kennen. Die Gottesdienste waren immer voll, auch bei Superintendent Russe, den doch viele nicht mochten. Das geflügelte Wort fand sich bestätigt, nämlich, dass man in Vorpommern niemand hineinpredigen könnte (in die Kirche, zum Gottesdienst) und in Hinterpommern keinen hinauspredigen. Es waren schöne Monate, es war ja noch Sommer, außer den sonntäglichen Predigten und etwas Konfirmandenunterricht, war nicht viel zu tun. So war ich denn viel mit dem jungen Tierarzt unterwegs bei seinen Patienten, weil meine keine Zeit hatten, krank zu sein. So geschah es denn auch, das wir meinen Geburtstag, der beim Tierarzt gefeiert werden sollte, dann bei einem kranken Bullen im Stall verlebten. Doch ohne Schatten war diese Zeit auch nicht, in Deutschland tat sich vieles, von dem man nur Unbestimmtes hörte. Aus seiner Stettiner Sicht hatte mir Max Heinrich Flos erzählt, das es seltsam wäre, wie viele derer, die in Schutzhaft genommen wären oder in Lager kämen, an Lungenentzündung stürben und die Angehörigen erst davon erführen, wenn man sie aufforderte, die Urne abzuholen. Auch das man mit den Juden nichts Gutes vorhätte, sprach sich immer mehr herum. Viele von ihnen begannen die Möglichkeiten zum Auswandern oder Fliehen, die noch bestand, zu nutzen. Andere aber konnten sich dazu nicht entschließen, meinten wohl auch, sie könne es ja nicht treffen, da sie ja an ihrem Wohnort keine Feinde hätten. So meinte auch das junge jüdische Mädchen, das mich im Dunkeln, zu später Stunde aufsuchte, hier, in Jakobshagen würde ihnen doch niemand etwas tun, ob denn wirklich auch für sie Gefahr bestünde? Ich bestätigte ihr, dass auch ich überzeugt sei, dass ihnen, den beiden jüdischen alteingesessenen Familien kein Jakobshagener etwas tun würde, aber die anderen ! und riet dringend zur Flucht. Gott sei Dank taten sie es schon bald. Doch noch ein anderes etwas erfreulicheres Jakobshagener Ereignis ist mir in Erinnerung geblieben, die 600 Jahr-Feier des Städtchens. Für die Festschrift habe ich eine kleine Zeichnung der Kirche beisteuern können, wegen der Enge der Straße war eine fotografische Aufnahme nicht möglich. Da für Jakobshagen nur ein halbes Jahr geplant, es auch mein Wunsch war, Hinterpommern und Vorpommern kennen zu lernen, übernahm ich im Oktober 1936 die Pfarramtliche Betreuung der Gemeinde Dargitz bei Pasewalk, zu der das große Fabrikdorf Jatznick gehörte, aber auch die Domäne Schönwalde, die Bauerndörfer Stolzenburg und Dargitz und die Büdnerdörfer Sandkrug und Sandförde, also eine sozial sehr unterschiedliche Bevölkerung in einer Pfarrgemeinde. Aus dem kirchlichen Hinterpommern, wo es weitgehend noch zur festen Sitte gehörte, dass Sonntag für Sonntag wenigstens ein Glied jeder Familie im Gottesdienst war, war ich nun also nach Vorpommern gekommen, das ich kannte und von dem ich wusste, dass es eben gar nicht Sitte war, dass man regelmäßig zum Gottesdienst ging und schon gar nicht die Männer. Man ging nicht „rein“, d.h. zum sonntäglichen Gottesdienst, man ging aber auch nicht „raus“, d.h. man trat auch nicht aus der Kirche aus. Das traf auch weitgehend für Jatznik, das „rote“ Arbeiterdorf zu. Wo man diese „Randsiedler“, das Wort lieb ich nicht sehr, aber man gebrauchte es, jedoch recht zahlreich antraf, das waren die Kasualien, besonders die Beerdigungen. Hier aber bemühte ich mich deutlich, das Evangelium zu verkündigen angesichts dieses betreffenden Falles und nicht etwa dem Unmut darüber Raum zu geben, das sie so „schlechte“ Christen wären. Wie in den kleineren Gemeinden bisher begann ich auch hier nun Haus für Haus zu besuchen. Bei drei Kirchen, alle 14 Tage hatte ich drei Gottesdienste mit anschließendem Kindergottesdienst, dazwischen 2, aber oft noch ein Hausgottesdienst in Schönwalde oder Sandförde dazu, bei 2 Konfirmandengruppen (in Dargitz und Jatznick) und bei den der großen Gemeinde entsprechend häufigen Amtshandlungen war es nun aber unmöglich, die Arbeiten für das 2. Examen und die Vorbereitung für die mündliche Prüfung nebenbei zu machen. Ich musste, wenn auch ungern, das Konsistorium bitten, mich in Hinblick auf die Prüfung auf eine leichtere Stelle zu setzen (die Pfarre Dargitz wurde später auch geteilt). Zur Zeitgeschichte wäre noch zu berichten, dass die Lehrer, die ein kirchliches Nebenamt hatten hier in Jatznick und Dargitz trotz Druck von Kollegen und Partei (in Jatznick gab es ja eine ganze Reihe von Lehrern, soweit ich mich erinnere) nicht nur ihr Organistenamt treu verwalteten, sondern auch wirklich christlichen Religionsunterricht noch erteilten. Auch die Familie des Patronatsvertreter, des Domänen(-Staatsgut)pächters in Schönwalde ist mir als beispielhaft in ihrer christlichkirchlichen Grundhaltung in Erinnerung. Auch wenn schon in 2 oder 3 Generationen dort ansässig, war hier der sonntägliche Gottesdienst Sitte und Ordnung. Als kurios empfand ich in diesem Haus, dass es dort kein elektrisches Licht gab. Die Energie für den landwirtschaftlichen Betrieb lieferte eine Dampfmaschine, in den Häusern aber waren die Räume vom warmen Licht der Petroleumlampen erhellt, die in der Hausdiele für den jeweiligen Bedarf bereitstanden. In Plönzig Kreis Pyritz, wohin ich nun Anfang April 1937 nach den beiden Konfirmationen in Dargitz und Jatznick und den Ostergottesdiensten übergesiedelt war, waren zwar auch drei Predigtstätten, jedoch bei weit geringerer Seelenzahl. Auch lernte man seine Gemeindemitglieder schon weitgehend in und nach den Gottesdiensten kennen. Der Amtsvorgänger war gestorben, das Pfarrhaus ohne Möbel, so wohnte ich beim Briefträger oben in einem kleinen Zimmer, Wand an Wand mit dem Junglehrer, mit dem ich mich gut verstand. Im Rückblick erscheint mir dieser Sommer 37 in hellem sommerlichen Licht, mit genügend Muße für die schriftlichen Arbeiten und ohne besondere Vorkommnisse, es sei denn, dass ich einmal mit dem ausnahmsweise geborgten Sachsmotorrad (Moped) meines Quartierwirts in eine Kuhherde auf der Dorfstraße geriet, glücklicherweise ohne besonderen Schaden für das Moped. Am 9. September fuhr ich dann nach Stettin, wo vom 15. ab beim Konsistorium die mündlichen Prüfungen waren, die erwartungsgemäß mit im Ganzen gut bestanden wurden. Am 28. September war dann die Ordination in der Schlosskirche in Stettin, mit dem Vermerk, dass ich zum Hilfsprediger für den Provinzialverein für Innere Mission bestimmt sei. Womit gemeint war, dass Jochen Fuchs und ich , wir Kandidaten aus der Jugendbewegung, für geeignet angesehen waren, im kommenden Winter gemeinsam Volksmissionswochen in verschiedenen vakanten und anderen Pfarren durchzuführen. Für die winterlichen Witterungs- und Wegeverhältnisse wurden wir Mitte Oktober, nachdem ich am 10. Oktober in der Pfarre Plönzig die letzte Taufe und die letzten Gottesdienste gehalten hatte, in Stettin auf Kirchenkosten mit Stiefel, Stiefelhose, Lodenmantel und Skimütze ausgerüstet, um dann mit Pastor Besch, dem späteren Präses von Bremen, als dem Leiter der I.M. das Einzelne zu besprechen und um uns vorzubereiten. Der erste Einsatz war in der Pfarre Kronheide bei Stettin vom 25. Oktober bis 7. November. Vormittags und nachmittags machten wir getrennt Besuche, am Abend übernahm jeweils der eine die Bibelstunde und der andere die Schlussandacht. Beide standen unter klar herausgestellten Themen. Bei den Bibelstunden z.B. Kinder, Taufe, christliche Eltern, Hausgemeinde, Sonntag, Beichte, Abendmahl. Bei den Andachten: Liebe der Schlüssel, Glaube und Kraft, Wahrheit nach dem jeweiligen Text der lfd. Bibellese. Den Themen entsprechend hatten wir im Koffer einen kleinen Schriftentisch mit, den wir zu jedem Gemeindeabend aufbauten. Die Wochen schlossen jedes Mal mit einem großen Gottesdienst, zu dem eine Posaunengruppe der Züllchower Diakonien und oft auch Besch kamen. Weitere Volksmissionswochen, heute sagt man wohl „kirchliche Wochen“ führten wir dann vom 11. bis 21. November in Kladow-Kehrberg, westlich Bahn durch, vom 29.11. bis 12.12. waren wir im Kreis Regenwalde. Auf Rügen sollte vom 3.01 1938 für 14 Tage eine Woche in der Pfarre Rapin sein, die aber wegen Verbot abgebrochen werden musste. Ungehindert aber konnten wir vom 20.01. bis 30.01. in den Pfarren Starkow und Velgast sein und vom 04.02. bis 13.02. in Bodstedt Kreis Barth. In der Pfarre Sassen waren, natürlich wie überall verbunden mit Besuchen in allen Dörfern und Ausbauten, die Abende vom 25.02. bis 06.03. In Wieppkenhagen Kreis Barth waren wir vom 12.03. bis 16.03. Den Schluss machte die Woche im Pfarrbezirk Zarnekow Kreis Greifswald. Meinem Amtskalender konnte ich diese Daten noch entnehmen, sonst hätte ich sie sicher nicht mehr bringen können, zu viel war ja in dieser kurzen Zeit an Eindrücken auf uns eingestürmt und das bei einem Höchstmaß an körperlicher und geistiger Beanspruchung. Wunschgemäß wurden wir danach, Jochen Fuchs und ich , im gleichen Kirchenkreis, in Pfarrstellen eingewiesen und uns, obwohl das Hilfspredigerjahr ja noch nicht beendet war, gestattet, uns um diese Pfarrstellen zu bewerben. Ich machte davon aber keinen Gebrauch, weil ich mir noch so sehr jung vorkam. Ich wollte zunächst für ein paar Jahre Auslandspfarrer werden oder eine reine Männergemeinde übernehmen, etwa als Wehrmachtspfarrer. Für Brasilien, wohin Max Heinrich Flos mir 1 Jahr vorausgereist war, entschied ich mich dann aber doch nicht, weil man, das war neu, 6 Jahre ohne Heimaturlaub bleiben sollte. Eine Reise über den großen Teich dauerte zu der Zeit noch drei Wochen und mein Vater war schon fast 65 und war kränklich. Das Andere aber schien glatt zu gehen, ich hatte mit Erfolg meine Probepredigt in der Garnisonskirche in Stettin gehalten, bekam aber dann keinen definitiven Bescheid aus Berlin. Anlässlich einer Reise nach Berlin sprach ich bei Dohrmann vor und erfuhr, dass die Parteileute in Altenhagen nicht gut auf mich zu sprechen waren. Bald darauf wurde ich als Angehöriger des Jahrganges 1910 zum Wehrdienst für kurze Zeit eingezogen, konnte danach aber noch ein Jahr mein Pfarramt verwalten bis ich Anfang September 1939 dann für fast 10 Jahre Soldat sein musste. Erst Ostern 1948 kehrte ich aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft zurück. Nicht mehr nach Altenhagen, sondern nach Usedom. 1942 hatte ich mir in Russland einen Leberschaden, nach einer verschleppten Gelbsucht zugezogen, der mir nach ärztlichem Urteil eine weitere Tätigkeit in einer Landpfarre verbot. Mit dem 19.01.1944 berief mich daher das Konsistorium auf Grund der Wahl des bevollmächtigten Ausschusses in die erste Pfarrstelle in Usedom. Im Jahr vorher hatte ich während eines Urlaubs Anneliese Warsow, die Tochter des Gutsverwalters von Vitense geheiratet, nachdem ich sie während eines Urlaubs vorher kennen gelernt hatte (der Hochzeitsurlaub galt als Sonderurlaub). Diese Ehe wurde kurz nach meiner Heimkehr 1948 wieder geschieden. Aus den Gründen, die zu meiner Scheidung geführt hatten, konnte ich nun auch mein Amt in Usedom nicht antreten. Ich kam daher der Bitte von Superintendent Lic. Scheel nach und ging nach Kagendorf. Hier war ich in der Nähe der Eltern, worüber sie froh waren, zumal ich sie oft besuchte, weil ich viel in Anklam zu tun hatte. Eine Pfarrwohnung musste gebaut werden, mehrere Kirchen repariert und benutzbar gemacht werden; das bedeutete: viele Wege zu Behörden und Handwerkern waren nötig. In Anklam lernte ich nun Eure Mutter kennen, die das Kinderheim in der Hospitalstraße leitete. Wir heirateten bald und ich war glücklich, nun ein eigenes Zuhause, eine eigene Familie zu haben. In der Kirchengemeinde war sehr viel zu tun, sie umfasste 8 Dörfer mit 6 Kirchen und Kapellen, fast 3000 Menschen wohnten da (durch den Zuzug der Flüchtlinge hatte die Seelenzahl sich fast verdoppelt). Leider bestätigte sich bald das Urteil der Ärzte, dass ich nicht auf dem Lande bleiben sollte. Die Leberentzündung wollte nicht weichen, Winter für Winter musste ich für einige Wochen ins Bett und darauf zur Kur fahren. Als sich daher 1954 die Möglichkeit bot, die Pfarrstelle Dersekow bei Greifswald zu übernehmen, mit nur einer Kirche und einer Kapelle, entschlossen wir uns, wenn auch nicht leicht, Kagendorf zu verlassen, wo Ihr drei Älteren im Rohr gedeckten Pfarrhaus geboren wurdet, das ich als letztes Gebäude des Pfarrgehöftes vorgefunden hatte (es war der Stall gewesen, den wir mit großer Mühe ausgebaut hatten).
In Dersekow zogen wir in ein Pfarrhaus, das mehr einem Gutshaus glich, doch hatten wir zunächst nur sehr unzureichend Raum für uns, weil außer uns noch 5 Parteien im Haus wohnten und die Schwesternstation darin war. Gemeindlich herrschten anfangs sehr günstige Verhältnisse insofern als noch Kirchendiener, Organist, Katechetin da waren. Auch bestand noch ein Kirchenchor und Teile der Gemeindesiedler aus Westfalen und Hessen und Flüchtlinge aus Ostpreußen und Hinterpommern ließen sich noch recht willig nicht nur zu Bibelstunden, sondern auch zu Helferrüsten rufen. Sup. Wilm hatte mich für diese Arbeit gewonnen. Nach und nach aber verschlechterten sich die Verhältnisse, die Gottesdienste in den Außengemeinden, die Christenlehrestunden in den Schulen mussten eingestellt werden. Organist und Kirchendiener legten ihre Ämter nieder, schließlich bekamen wir auch keine Katechetin mehr. Mit dem Einrichten der LPG in den Dörfern verschwanden auch die meisten kirchlichen Siedlerfamilien. Das bedeutete Mehrarbeit, aber nicht nur für mich, sondern auch für Eure Mutter, die nun neben dem arbeitsaufwendigen Pfarrgrundstück (Haus und Garten) noch neue Arbeit dazu bekam, vom Betreuen der Kinder bis zur Unterrichtsstunde bis hin zum Organistendienst und Kirchendienst. Für Euch Kinder aber war Dersekow Heimat, schöne Kinderheimat. An Vieles werdet Ihr Euch solange Ihr lebt erinnern, an die Tiere, mit denen wir dort lebten, Troll und Prinz und die Schildkröte, an die Generationen der Schafe, vielleicht auch an die Bienen, aber auch an die Diele, an die Veranda, an die Räucherkammer, an die Buden im Garten, den Teich, an die vielen schönen Feten und Feste. Im Oktober 1976 zogen wir nach Anklam, weil ich ja inzwischen das Rentenalter erreicht hatte und weil sich die günstige Möglichkeit bot, die Ruhestandswohnung im väterlichen Haus zu beziehen Einen „Platzhalter“ aber ließen wir in Dersekow: Fridegard und ihre Familie.