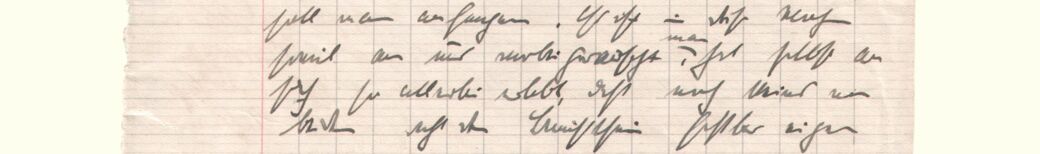Rückblicke
Pfarrer und Soldat
Nach Beendigung der Hilfsdienstzeit sollten wir dann auch, wenn wir es wollten, eingeführt werden. Ich aber wollte, als sich die Bewerbung um ein Pfarrdienst in Brasilien, als für mich nicht geeignet erwiesen hatte, auf Zeit Militärpfarrer werden, hatte auch in Stettin in der Garnisonkirche schon gepredigt und die Zusage auf baldige Berufung bekommen, auf die ich im Sommer 38 wartete. Aber als ich persönlich in Berlin nachfragte, erfuhr ich, dass die Partei meine Berufung vereitelt hatte. Haben Sie etwas mit Ihrem Ortsgruppenleiter? So fragte mich Bischof Dohrmann. Und ich antwortete: Nun, wir lieben uns nicht. Ja, das ist es! Ob und wann ich mich nun um meine Einführung in Altenhagen, das mir inzwischen lieb geworden war, bemüht habe, weiß ich nicht. Kaum hatte ich meine neue Gemeinde Haus für Haus besucht, da wurde ich jäh aus der Arbeit durch eine Einberufung zum Militär herausgerissen. Der Jahrgang 1910 wurde kurzfristig ausgebildet. Das bedeutete für mich in der Zeit vom 11. Juli bis zum 14. August, eine Fahrt im Truppentransporter von Rostock nach Pillau und dann Truppenübungsplatz Stablack in Ostpreußen, diesmal nicht "hinhaltende Verteidigung", sondern "Angriff auf feste Stellung". Ein Feldgottesdienst war allerdings auch dabei.
Doch dann konnte die Pfarramtstätigkeit wieder aufgenommen werden, aber jetzt nicht nur die seelsorgerliche Seite, sondern auch allerlei Verwaltungskram: Pacht, Mieten, Etat und dazu Steuerlisten verschiedenster Art aufstellen, Grundsteuer, Einkommensteuer u.a. Angenehm war dagegen die Beschäftigung mit dem schönen Garten, wo ich ernten konnte, wo ich nicht gesät hatte. Spargel, Erdbeeren und Obst konnte ich sogar noch verkaufen, was meinem kargen Hilfspredigergehalt gut tat. Von vielen Seiten erfuhr ich Unterstützung; da war nebenan der Pfarrpächter, bei dem ich Milch und Butter kaufte, der zwar zu Dienstfahrten mit dem Kutschwagen, den ich vom Vorgänger geerbt hatte verpflichtet war, es aber auch mit seinem Auto tat (ich selber sparte erst auf einen Volkswagen); da war die Frau des Maurers, bei der ich einen Mittagstisch hatte, da war Frl. Schöttler, die mir die Wäsche besorgte; da war in Tützpatz der Lehrer Fuchs, christlicher Mann, der wirklich Religionsunterricht gab und nicht wie sein Kollege in Altenhagen, der das Organistenamt um des Geldes wegen behielt, auch Religionsunterricht erteilte, aber die Stunden benutzte um nationalsozialistische Glaubenslehre zu predigen. Es waren noch viele Andere, nur diese seien genannt. Zu vergessen sei allerdings auf keinen Fall das Ehepaar von Heyden-Linden in Tützpatz. Er war Patron der Pfarre und nahm dies Amt sehr ernst, was gerade damals sehr wichtig war. Hier wurde ich auch zu Tisch gebeten, wenn ich nach dem Gottesdienst in Tützpatz am Nachmittag noch in Pripsleben zu predigen hatte.
Selbstverständlich stellte er mir dann auch die Kutsche zur Fahrt dahin und von dort nach Hause zur Verfügung, wenn es nicht mein guter Ältester Malte. tat. Tützpatz war gewiss noch alte Zeit. Der Gutsbesitzer fühlte sich noch verantwortlich für seine Leute, er war der "gnädige Herr". Die Frau, die "gnädige Frau" kümmerte sich um das leibliche Wohl der Frauen im Dorf. Diese patriarchalischen Verhältnisse prägten das Bild des Dorfes, in dem die Tagelöhner - anders als anderswo - seit Generationen bodenständig geblieben waren, wie ich es in den Kirchenbüchern belegt fand. Persönlich anspruchslos und bescheiden unterhielten Heyden-Lindens das schöne Schloss, den nicht minder wertvollen Park, ja das ganze Dorf. Adel verpflichtet! Auf Etikette wurde geachtet und wie es zu sein pflegte - der Diener achtete am strengsten darauf. Ich muss jetzt noch schmunzeln, wenn ich daran denke, wie ich ihn ohne es zu wollen, einmal in Verlegenheit gebracht habe.
Ich hatte im Dorf Besuche gemachte und wollte dann noch eine Frau sprechen, die in der Schlossküche arbeitete und schließlich noch den Patron in einer wichtigen Sache sprechen. So hatte ich auch den Weg nun mir zurechtgelegt, ging vom Nebeneingang in die Küche im Untergeschoß und dann die Treppe hinauf in das Vestibül, wo ich hoffte, den Diener zu treffen, damit er mich anmelde. Ich traf ihn auch: "Aber Herr Pastor, Sie dürfen doch nicht den Nebeneingang benutzen!" Und noch ein Döntjes, also nichts Besonderes, aber es zeigt, wie man in diesen Kreisen noch dachte. Ich war 1940 Leutnant geworden, bald danach hatte ich Urlaub, den ich selbstverständlich in Altenhagen verbrachte, um anstehende Amtshandlungen zu vollziehen, die Nachbarn mussten ja vertreten. Da fragte mich eines Tages Frau von Heyden-Linden fast schüchtern, ob sie mich nicht jetzt "Herr Leutnant", nennen sollten. Ich hebe darauf gelacht und wohl gesagt ein Pastor wäre doch noch mehr als ein Leutnant. Wann ich zum letzten Mal Urlaub in Altenhagen machen konnte, weiß ich nicht mehr. Der Krieg endete nicht so schnell, wie wir hofften, so hatte das Konsistorium einen Diakon ins Pfarrhaus gesetzt, der nicht gut mit meiner persönlichen Habe umging. Dass sich niemand dagegen stark gemacht hatte, hat mich natürlich geärgert. Andererseits meinen Entschluss erleichtert, mich um eine Stadtpfarre zu bewerben, weil die Ärzte mir meiner erkrankten Leber wegen dringend dazu rieten. Mir wurde Usedom angeboten, wo mich nach der Probepredigt der Ältestenrat wählte.
Dass alle mir wohlgesinnten Leute mich verheiraten wollten war klar, denn nach damals noch ganz fester Über-zeugung war ein Pfarrhaus ohne Pfarrfrau unmöglich. Alle mir offerierten Kandidatinnen waren gewiss voll geeignet gute Pfarrfrauen zu werden, auch wohl treue Gefährtinnen, aber schon, dass man sie mir "aufschwatzen" wollte, gefiel mir nicht. Das war sicher dumm von mir, denn als ich dann selbst wählte, ging es nicht gut. Nach meinem Kururlaub 1943 - die Leber war immer noch krank - lernte ich im Zug Anneliese Wasow kennen, ein frisches, allerdings noch sehr junges Mädchen, die mir sofort gefiel. Sie war die Tochter eines Gutsverwalters. Gewiss kamen mir auch Bedenken: Zu jung, mitten im Krieg, du krank. Doch sagte ich mir: Der Krieg kann noch lange dauern, du bist alt genug, und wenn du nicht wieder kommst, lebt wenigstens ein Kind von dir. So heirateten wir am 6. August 44.
Weil ich in Usedom gewählt worden war, ist Anneliese dann auch bald dort ins Pfarrhaus gezogen. Nun muss kurz erklärt werden, was es mit der kranken Leber auf sich hatte. Schaden nach Alkoholmissbrauch kam ja - siehe Jugendbewegung - nicht in Frage. Der Grund war vielmehr, dass eine "Hepatitis epidemica" nicht erkannt und rechtzeitig behandelt wurde. im Sommer 1942 auf der Krimm fühlte ich mich ziemlich plötzlich schwach, auch das Koppel drückte auf der rechten Seite, Stiche nach unten ließen mich an eine Blinddarmreizung denken, was der Arzt jedoch ausschloss, aber meinte, es könnte vielleicht ein Zahn die Ursache sein, den dann jedoch der Zahnarzt im Krankenhaus in Simforopol nur mit großer Schwierigkeit entfernen konnte und schließlich als gesund erkannte. Was nun? Etwas gelb war ich allerdings, doch führte man dies auf das Atebrin zurück, was wir gegen Malaria einnahmen. Dies alles war im Juni, im August wurden wir nach Norden verlegt. Auch nach einem Urlaub im Oktober fühlte ich mich ständig matt, konnte kaum schlafen und das Essen schmeckte mir nicht, so dass eines Tages der Chef mit mir zum Divisionsarzt fuhr, der zum Glück Internist war und die richtige Diagnose stellte. So kam ich sofort am 26. Nov. ins Lazarett in Nikolskoje, wurde im Lazaretzug am 23. Dezember verladen nach Tapiau verlegt und kam von dort zur Behandlung nach Posen ins Diakonnissenkrankenhaus. Als GVH (Garnisonverwendungsfähig Heimat) wurde ich zum Ersatztruppenteil nach Guben entlassen. Dort gefiel es mir aber gar nicht, so dass ich bat, das GVH in GVF (Garnisonverwendungsfähig Feld) zu ändern, denn ich wäre ja beim Stab, einen Arzt in der Nähe und Diät wäre auch möglich. So wurde ich wieder zur Truppe entlassen, ahnte allerdings nicht, was mir nun künftig bevorstand.
Zunächst aber konnte ich auf der Fahrt dorthin, in Libau meinen Bruder Helmut für einige Stunden sprechen, der dort bei der Marine Flak war. Dies Zusammensein hat mir viel bedeutet, und ich sehe es noch immer als eine gütige Fügung an. Er fiel noch bei Triest am 2. Mai 1945.
Gott hat seine Hand über mir - Erlebnisse zum Kriegsende
Was kam auf mich zu?
Das Blatt im Kriegsgeschehen hatte sich gewendet, es ging kaum noch voraus, es galt die Front zu halten. Und das war oft bei der Zahlenmäßigen Überlegenheit des Gegners schwer. Die 28. Jägerdivision, bei der ich war, wurde oft zu Hilfe gerufen, was oft dazu führte, dass wir eingeschlossen waren, wenn bei den Nachbarn dem Feind ein Einbruch gelungen war.
So mussten wir uns u. a. am Ilmensee durch eine großes Sumpf- und Moorgebiet zurückkämpfen, dass so stark von Partisanen besetzt war, dass es diesen, als unsere Marschkolonne abriss, gelang eine Baumsperre von 100 m zu legen. Dass unter diesen Umständen für mich weder an Diät noch an eine einigermaßen geeignete, d.h. der kranken Leber entsprechende Unterkunft in den Pausen zu denken war, braucht nicht betont zu werden. Auch als wir im Mittelabschnitt bei einem solchen Einsatz eingekesselt worden waren, zwar durch den Einsatz unseres Generals der Gefangenschaft entgingen, weil er eine Panzerdivision veranlasst hatte, uns einen Korridor zu schaffen, durch den wir unter Zurücklassen aller Fahrzeuge usw. mehr als 30km ohne Pause zurückmarschieren konnten, war das für mich, zumal ich wieder Fieber hatte, eine Strapaze. Das galt natürlich für die letzten Kämpfe in Ostpreußen in besonderer Weise, wo wir ja aus einem Kessel in einen andern gerieten und hautnah den feindlichen Waffen, Panzern, Tieffliegern und Artillerie ausgesetzt waren. Was ich damals erlebt habe, wird mir immer in "guter" Erinnerung bleiben.
Zum Beispiel, wie gute Menschen mir helfen wollten, Gott aber einen besseren Plan für mich hatte. Bei Balga, in der Dunkelheit angekommen, hatte ich sofort befohlen, dass jeder Mann sich eine Schutzgrube ausheben sollte, so lang wie er, nicht breiter als 1 Meter und mindestens auch 1 Meter tief, weil ich wusste, dass wir sobald es hell werden würde, von sowjetischen Flugzeugen angegriffen werden würden. Auch für mich ließ ich ein solches ausheben. Wie richtig das war, sollte sich bald zeigen, als wir, der Hauptfeldwebel, der Schreiber und ich uns kurz hinausgewagt hatten, um Dringendes zu besprechen. Unbemerkt von uns hatte uns ein Flugzeug schon im Visier; ich sah ein Aufblitzen am Himmel, auf mein Wink hin reagierten die beiden andern um Bruchteile von Sekunden zu spät und wurden verletzt. Ein Freiwilliger, übrigens ein Russe, brachte sie in rasender Fahrt auf einem Panjewagen zum Feldlazarett in Balga, von wo sie wohl am folgenden Tag auf ein Lazarettschiff gebracht wurden. Wie ich später erfuhr, waren sie in ein Heimatlazarett gekommen und ihnen die Gefangenschaft erspart geblieben.
Doch nun zu mir. Bald nach diesem Zwischenfall kam von Loch zu Loch springend ein Melder von der Division, die im Steilufer ihren Gefechtsstand hatte mit dem Befehl, ich solle mich dort in Balga melden. Ich war alles anders als begeistert von diesem Befehl, doch Befehl ist Befehl. Kaum dort angekommen erlebte ich das, was Frauen und Kinder in den großen Städten oft Nacht für Nacht erlebten, das Rauschen der Bomben, das Bangen, trifft es uns? Wem hat es Leid oder gar Tod gebracht. Wir waren verschont geblieben, doch Bunker unter uns und über uns waren getroffen worden. Und dann erfuhr ich, dass nichts Besonderes vorlag. Der General hatte es gut mit mir gemeint, denn beim Div. Stab gefangen zu werden bot eine größere Chance als Kranker zu überleben. Beinahe wäre es nun doch mein Verderben gewesen, Menschenplanen ist nun einmal unvollkommen, doch dies "Gutes wollen" hat Gott - so war es mir ganz deutlich - benutzt, um mir das Leben zu erhalten. Denn kaum sei ich fort gewesen, so erfuhr ich am nächsten Tag sei mein "Schutzloch" von den Bordwaffen eines Flugzeuges voll getroffen worden.
Und dann Peise, auch das habe ich nicht vergessen. Wieder wollte man mir helfen, aber es wäre nicht gut ausgegangen, und ein andrer wollte mit Böses, das aber rettete mich. In Balga hatten nur die Mannschaften von Marinefähren fortgebracht werden können. Die Pferde sollten vorher erschossen werden, was jedoch nicht mehr getan werden musste. Weil wir sie nur unvollkommen schützen konnten, waren sie alle dem feindlichen Beschuss zum Opfer gefallen. Es gab also keine bespannten Mun-Kolonnen mehr, ich war zum Feldersatzbataillon gekommen, wo mir in der Nacht bei abgeblendeter Taschenlampe eine Inf. Kompanie übergeben wurde, von der ich keinen Menschen kannte, mit dem Befehl eine Stellung zu halten bis gegen Morgen die Nachbarkompanie durch meine Stellung hindurch abgezogen sein würde. Im Munitionsbunker, die Uhr zur Sprengung tickte schon, wartete ich mit Hauptfeldwebel und Melder auf diesen Augenblick. Als mir das Zurückgehen der Nachbarkompanie gemeldet worden war, überzeugte ich mich mit den Zugführern m. Komp. Davon und als niemand mehr kam, gab auch ich den Befehl zum Rückzug ans Ufer, wo sich alle im Morgengrauen eingruben. Weil die Löcher aber sofort sich mit Wasser füllten, setzten wir uns auf die Stahlhelme. Als ich dann, es wurde langsam hell, Ausschau nach Bekannten hielt, rief mich der Divisionskommandeur an: "Becker kommen sie, legen Sie sich zu uns, es laufen Kapitulationsverhandlungen." Doch fast im selben Augenblick schnauzte mich ein junger Hauptmann an: "Warum sind sie nicht bei ihrer Kompanie und warum haben sie zu früh die Stellung geräumt?" und fuchtelte dabei mit seiner Pistole herum. Ich dagegen: "Wo ist denn meine Kompanie? Sie wissen ja selbst, mir ist sie in der Nacht bei abgeblendeter Taschenlampe übergeben worden, ich kenne keinen einzigen Mann und was das Andre angeht, so ist das eine Unterstellung, fragen sie den Feldwebel!" Ich tastete auch nach meiner Pistole. Sollte ich mich von diesem "Endsieger" noch umbringen lassen? Da bestätigte wieder fast im selben Augenblick ein Hauptmann, dass ich korrekt gehandelt hatte. Darauf der junge Hauptmann: "Dort in der Nähe des Wassers liegt ihre Kompanie." Nun gut dachte ich - mit einem Blick mich vom General verabschiedend - es ist ja gleich, wo ich bei der Kapitulation liege. Und ich begab mich dort hin, grub mir auch ein Loch und wartete.
Da aber begann meine Rettung. Der gute Wille des Div. Kommandeurs hätte mich vermutlich das Leben gekostet. Wie ich später im Gefangenlager erfuhr, hatten die dort in Gefangenschaft geratenen Soldaten 40 km im Eilmarsch ohne Pause zurücklegen müssen und jeder, der nicht mithalten konnte, wäre erschossen worden. Das wäre auch mein Schicksal gewesen, denn ich war durch die Strapazen geschwächt und hatte wieder Fieber. Der dagegen, der mir übel wollte, hatte mich an die Stelle gebracht, von der aus ich bald danach der Gefangenschaft entrinnen konnte.
Dazu in Kürze: Auf der anscheinend menschenleeren Wiese tauchten plötzlich Köpfe auf, die auf die See blickten. Noch nur schwach zu erkennen näherten sich kleine flache Marinefähren, zwei wie sich herausstellte, auf die hin nun die Soldaten zuströmten. Auch ich war aus dem Loch gestiegen, traf auf die beiden Divisionspfarrer. Zu Dritt überlegten wir, was wir zu tun hätten. Weil auf dieser Fähre, die jetzt angelegt hatte, nur etwa 100 Mann, dicht an dicht stehend abtransportiert werden könnten, auf einer zweiten auch nicht mehr, kamen wir zu dem Schluss, dass die Pfarrer bei dem weitaus größeren Teil der Truppe bleiben müssten, ich mich aber, wenn möglich, der Gefangennahme entziehen müsste. Das aber schien zunächst auch nicht möglich, weil diese erste Fähre inzwischen abgelegt hatte, kurz bevor ich sie erreichen konnte.
Doch was geschah? Kaum war sie aus dem Landschatten heraus, wurde sie vom Packgeschütz des Feindes getroffen und ihr Heck war leer gefegt, dort aber hätte auch ich gestanden. Währenddessen hatte die zweite Fähre angelegt, auf der auch ich noch einen Platz gefunden hatte. Großartig reagierte nun der junge Kommandant unseres Schiffes, er nebelte sofort das havarierte ein, setzte uns auf einer kleinen Insel ab, holte die noch schwimmende Fähre und die noch darauf befindlichen Soldaten nach Pillau. Schließlich brachte er auch uns dorthin, wo ich nach einigem Suchen den 1B der Division fand. Dies Suchen war nicht ungefährlich, weniger des Artilleriebeschusses wegen, dem wir ja schon lange. Immer wieder einmal ausgesetzt waren, als der Gefahr wegen, die vom "Heldenklau" ausging. Das heißt, jeder, der seine Zugehörigkeit zu einer Truppe nicht beweisen konnte, wurde entweder sofort einer schnell zusammengestellten Kompanie zugewiesen oder im schlimmen Fall als Deserteur gerichtet. Ich hatte also den 1B, den Oberstleutnant v. Wangenheim, erreicht und wurde sogleich kommissarisch Kommandeur der Divisionsnachschubtruppen. Mir unterstanden einige pferdebespannte Munitionskolonnen, was dazu führte, dass ich am 9. Mai 1945 noch einmal - zum letzten mal - ein Pferd besteigen musste bzw. durfte. Ich war zum Divisionsstab befohlen worden. Um dort hinzugelangen, wurde mir ein Pferd gebracht, das Satteldruck hatte, ich musste also in den Sattel springen, was dem Tier sicher Schmerz bereitet hatte. Mir wurde mitgeteilt, dass der Krieg beendet sei und die Waffen zu ruhen hätten. "Endlich" so dachten wohl die meisten von uns. Was aber würde mit uns geschehen, wir waren ja keine Kriegsgefangenen! "Skoro damoi" sagten die Russen, "nur registrieren", das aber dauerte für mich drei Jahre; für meine Freunde noch ein Jahr länger.
Noch ein paar Tage vorher hatte mir der Oberstleutnant einen Platz auf einem Schiff Richtung Heimat angeboten, aber ich konnte es nicht annehmen, weil es nur für mich und nicht für die mir Untergebenen galt.
Und dann war es doch Gefangenschaft!
Nach und nach erfuhren wir, dass all unser Bemühen, die Sowjetarmee von der Heimat fernzuhalten, schon lange sinnlos war, weil man schon längst die neuen Grenzen festgesetzt hatte. Es war auch ohne Belang, dass wir erst nach der Kapitulation in die Hände der Gegner gefallen waren. Auch schon lange waren wir „zur Wiedergutmachung“ als Arbeitssklaven den Sowjets zugesprochen worden. Allerdings bemühte man sich den Grundsätzen der Genfer Konvention entsprechend zu handeln.
Schon auf der fahrt zum Gefangenlager begann das dreijährige Seminar: „Sowjetpraxis“ und „Vom Wesen des russischen Menschen“. So möchte ich einmal das nennen, was ich in den Jahren der Gefangenschaft sehen, erleben und begreifen lernte. Wichtiger und größer aber war und blieb bis heute das Geschenk brüderlicher Freundschaft mit Männern, die gleich mir damals erfuhren, dass Gott die nicht fallen lässt, die sich an ihn halten.
Die Fahrt ins Gefangenenlager.
Bis ins Einzelne kann ich nicht mehr sagen, wie es sich damit verhielt. Aber einige Szenen stehen mit jetzt beim Nachdenken wieder rechts genau vor Augen. Schon von unsern Einheiten getrennt, ein Marschblock aus lauter Offizieren, geführt von einem sowjetischen Gefreiten, Richtung Osten. Da versuchte noch einmal in die Kolonne eindringend ein Soldat jemanden von seiner Uhr und seinen Stiefel evtl. zu „befreien' - zur Zeremonie des ersten lockeren sich Begegnen gehörte das ja (ich hatte daher schon meinen Trainingsanzug über die Uniform angezogen, so dass Uhr und Stiefel nicht mehr zu sehen waren). Dieser Soldat aber hatte den tödlichen Fehler, gemacht, zu diesem Zweck in die Kolonne einzudringen. Der Gefreite sah es, stellte ihn zur Rede und schoss ihn nieder.
Und bald darauf eine zweite Szene: Weil man uns schnell zum Verladebahnhof transportieren wollte hatte man uns auf LKW verladen, doch war es keine reine Gefangenenkolonne, sondern dazwischen fuhren auch sowjetische Truppen, und das noch wilder als sonst, weil „wöna kaput“. Da fuhr unser Fahrzeug auf das vor uns auf, nur leicht, aber einem Soldaten, der dort halb außenbords saß, wurde ein Unterschenkel so schwer getroffen, dass es hin und her pendelte. Aber keiner kümmerte sich um den Verletzten. So hart gingen sie mit einander um! Da musste ich daran denken, dass uns bei Dnepropetrowsk Menschen erzählt hatten, dass man den Staudamm des großen Wasserkraftwerks gesprengt hätte ohne die Bevölkerung zu verständigen, geschweige denn zu evakuieren. Und das, was uns an gräulichen Taten sowjetischer Soldaten, an Bewohnern ostpreußischer Dörfer verübt, berichtet wurde, wenn wir das Dorf zurückeroberten, gehörte dann irgendwie auch dazu. Vielleicht erklärt die jahrhunderte lange Versklavung durch immer wieder noch grausamere menschenverachtende Herren dies Tun. So war gewiss für die Russen der Transport in Viehwagen, ohne eine Möglichkeit sich zu entleeren, nur einmal am Tag hielt der Zug auf freier Strecke, nichts Schlimmes. Und das wir nach der Ankunft in Morschansk nagelneue Leinenbezüge empfingen, um sie als Strohsäcke benutzen zu können, geradezu eine noble Geste. Das die Strohmiete weitgehend durchnässt war, nun „nitschewo“.
Weil Kohlsuppe ganz und gar nichts für mich war, versuchte ich gegen eine Taschenuhr etwas Geeigneteres zu bekommen. Da bot mir ein Russe Zwieback an, worauf ich natürlich sofort zusagte und dann doch einigermaßen enttäuscht war, als sich russischer Zwieback als steinhartes Schwarzbrot entpuppte. Und dann der Marsch zum Lager außerhalb der Stadt „po piath“ (zu fünft , es lässt sich leichter zählen), am Straßenrand, die Bewohner der anliegenden Häuser, meist Frauen, die uns mit sichtbarem Mitgefühl betrachteten und etwas Neid, wegen der schönen Bezüge. Auf sandiger Höhe das Lager mit doppeltem Zaun und Wachtürmen, niedrige Holzbaracken, auch die Dächer aus Brettern. Der Appellplatz fast leer, einige Elendsgestalten von alten Gefangenen, die mit uns Kontakt aufnehmen wollten, wurden fortgescheucht. Dann wieder umständliches abzählen und erneutes Durchsuchen von Gepäck und Person, und schließlich einweisen in die Baracken. Langer Mittelgang etwa 1,5 m breit, rechts und links in 2, auch drei Etagen Pritschen aus Rundholz. Gut, dass wir die Strohsäcke hatten. Mitbewohner, wie wir bald feststellten, waren außer Wanzen, Flöhen und Läusen auch kapitale Ratten. Zunächst brauchten wir nicht zu arbeiten, wir begannen auch bald mit Gottesdiensten, es waren etwa 30 ev. und 2 kath., auch wohl 2 Orthodoxe Theologen im Lager. Vorträge und Arbeitsgemeinschaften auf vielen nur denkbaren Fachgebieten bildeten sich. Viel Zeit kostete auch die Anschaffung des Allernötigsten, eines Essgeschirrs (Oskar-Meier-Büchse) und eines Brotmesser zum Beispiel. Um von den Wanzen möglichst unbehelligt zu bleiben, nähte ich mir meine Decke zusammen, so dass sie ein Schlafsack wurde. Auch musste ein leichter Beutel her für die Brotration, der dann an einem Bindfaden an der Decke befestigt werden musste, bzw. an der Unterseite der oberen Pritsche. So war das Brot einigermaßen vor den Ratten sicher, die, während wir schliefen, oft genug über uns hinweghuschten.
Soviel davon, dann aber wurde uns eines Tages eröffnet, dass wir mit Ausnahme der Stabsoffiziere (ab Major) arbeiten müssten zur „Wiedergutmachung“ und von da an auch alle Rangabzeichen und Orden abzulegen hätten (hier bin ich mir nicht sicher, denn wir wurden weiterhin mit unserm Rang geführt, ja auch entlassen).
Das Hauptarbeitsobjekt für das Lager war wohl die Gasleitung von Saratow nach Moskau. Hier habe ich im Sommer 1945 auch einige Zeit mitgearbeitet. Abends musste oft noch das ganze Lager auf benachbarte Felder, um dort Tomaten und Kohlpflanzen zu begießen; es war ein heißer Sommer ohne wirkliche Regenperioden, nur gegen Abend gab es oft ein kurzes Gewitter. Im Lager selbst gab es allerlei Werkstätten (Schneider, Tischler), die weitgehend für die sowjetischen Offiziere arbeiteten; sogar eine Art Atelier, in dem Maler nach Postkarten Ölbilder für die Russen herstellten. Plätze in diesen Werkstätten waren natürlich sehr begehrt, wurden aber von dem Stamm eisern verteidigt, so dass es „Glücksfall“ war, als ich zum Winter hin in die Schneiderei kam, vermutlich weil mein Gesundheitszustand bedenklich schien und ein Freund nachgeholfen hatte.
Da die russische Diagnose der Po-Beschau - wir mussten nackend uns den Ärztinnen stellen und je nachdem die Gesäßmuskeln noch vorhanden waren wurde die Arbeitsfähigkeit festgesetzt - nichts brachte, quälte ich mich mit ständiger Mattigkeit und begann Pfeife zu rauchen und sagte mir, es ist ja gleich, ob dir so oder so schlecht wird. Doch tat ich das nur sparsam, denn der größte Teil des Tabaks, den wir zugeteilt bekamen, vertauschte ich gegen Weißbrot, denn das Mischbrot bekam mir nicht gut. Auch konnte ich die tägliche Kohlsuppe nicht vertragen, so dass meine Ernährung sehr einseitig war. Ich versuchte daher, wenn wir auf den Weg zur Arbeit in die Nähe des Basar kamen, ein paar Tomaten zu kaufen.
An einen Zwischenfall bei diesem Vorhaben erinnere ich mich noch sehr genau. Unser Bewacher, ein alter nervöser Mann, verbot mir den Kauf, obwohl wir mitten durch den Markt gingen. Wäre es ein Soldat gewesen, der uns bewachte, hätte der es ohne weiteres gestattet. Ich war also irritiert, und als nun noch ein junger Kerl wie triumphierend einen weit größeren Rubelschein hochhob und auf mich deutete mit meinem kleinen Schein in der Hand, da sagte ich mir: „Siehe, da wirst du noch verspottet. Aber, was willst du, du bist nun einmal ein pleni (Gefangener).“ und trottete in der Gruppe den Kopf gesenkt weiter. Da plötzlich war der junge Mensch wieder da, drängte sich zu mir durch und schüttete eine große Menge Tomaten mir in den Bausch des Russenhemdes, wollte auch mein Geld nicht und verschwand freundlich lachend. Solidarität unter den Armen oder besser Entrechteten wurde uns ständig zuteil. Uns gegen über waren sie offen und halfen uns oft in rührender Weise. Auch dort in Mitschurinsk im Eisenbahnausbesserungswerk arbeiteten neben uns junge Mädchen. Als wir sie fragten, wie sie denn hierher kämen, diese schwere und gefährliche Arbeit tun zu müssen, da erzählten sie uns: Nun da wäre ein LKW ins Dorf gekommnen und Uniformierte hätten alle jungen Mädchen, die gerade auf der Straße waren, gegriffen und hierher gebracht; sie wären auch in einem Lager. Eins dieser Mädchen hatte irgendwie ein paar Äpfel erwischt und ganz spontan gab sie mir auch einen. Auch die Posten waren meist kumpelhaft freundlich. Wenn das Zauberwort „kurit nada“ gefallen war, d.h. einer nach etwa 45 Minuten die Rauchpause anforderte, dann geschah es nicht selten, dass der Soldat dem, der keinen Tabak bei sich hatte, von seinem Machorka abgab.
Oder noch viel eindrücklicher ist mir in Erinnerung die Begegnen mit den russischen Frauen, als wir auf einem Waldkommando waren. Wir waren weit gefahren, weit und breit nur Wald, an Flucht war nicht zu denken, obschon die Posten verschwunden waren, um Beeren zu suchen und in der Mittagshitze zu schlafen. Wir hatten unsre Arbeit geschafft; Holz fürs Lager zusammen getragen, waren auch müde und durstig! Aber wo war hier Wasser? Da entdeckten wir am Rande einer Lichtung ein paar Häuser und davor Frauen. Wir gingen zu der ärmlichen Ansiedlung und baten um etwas Wasser. Sie brachten es uns, auch sogar etwas Milch und Sonnenblumen zum Knappern, alles schweigend, und dann fragten sie uns, wie geht es euch, werdet ihr satt, habt ihr Nachricht von euren Angehörigen? Und als wir sie fragten, da sagten sie, sie hätten schon lange keine Nachricht mehr vom Mann und den Söhnen. Warum sie uns so gut wären? Vielleicht tut auch unsern Männern jemand Gutes, das bedrückte uns sehr, denn wir hatten schon erfahren, wie schlecht es russische Kriegsgefangene hatten, und eine sagte leise „um Christi willen“. Und als sie erfuhren, dass ich Pastor sei erfuhren wir, was es heißt: Eins sein im Glauben an Ihn.
Das Lager Morschansk war ein Arbeitslager, wenn auch nicht ausschließlich. Wie ich schon erwähnte, brauchten die Stabsoffiziere nicht zu arbeiten, einige taten es feiwillig, sogar in der Latrinenbrigade, um eine höhere Lebensmittelzuteilung zu bekommen. Als Arbeitslager stand es in der jahrhundertealte Tradition der russischen Zwangsarbeitslager mit deren Grausamkeit und Menschenverachtung, gewiss zu unserer Zeit schon sehr gemildert, aber wir bekamen noch genug davon zu spüren; auch lernten wir die uralten Praktiken kennen, die in der Sklaverei dennoch zu beachtlichen Leistungen geführt hatten. Wir mussten nun auch in der Gefangenschaft mit Staunen und Bewunderung feststellen, dass auch mit den primitiven Mitteln aus uralter Zeit Probleme zu lösen seien - gewiss unter Missbrauch menschlicher Gesundheit -, wo wir meinen, hier muss Technik her. So hatten uns die Bauern, soweit sie nicht evakuiert worden waren, erzählt, wie die Sowjetische Armee sie gezwungen hatte zur Zeit der Schneeschmelze, als die Erdstraßen noch unbefahrbar waren, Tonnen mit Benzin und Öl bis zum nächsten Dorf zu rollen, von wo wieder die gesamte Bevölkerung es ebenso tun musste. So hatte also die Sowjetische Armee den Nachschub des Treibstoffs durchgeführt, während die deutschen Truppen im Schlamm versanken oder bis zum Abtrocknen der Straßen warten mussten. So bestand nun auch, als wir am Deich arbeiteten die ganze Technik in jeweils 2 Stangen auf die in der Mitte drei oder vier Bretter von ca. 60 -70 cm Länge genagelt wurden. So schleppten wir zu zweit die Erde vom Ort des Aushubs bis zum entstehenden Deich.
Sklavenarbeit aber geht nicht ohne Peitsche; die Peitsche damals waren die 50 Gramm Brot, die wir nur als Extraration bekamen, wenn uns bescheinigt wurde, dass wir das Soll erfüllt hätten. Das Soll aber wurde ständig heraufgesetzt (in der DDR war das dann ja nicht anders). Als das Soll am Deich nun nicht zu erfüllen war gingen wir zu dem Offizier, der die Aufsicht hatte. Er war uns wohl gesinnt: „Ach was, ich sehe ihr arbeitet. Soll wird nicht gearbeitet, Soll wird geschrieben. Ihr bekommt euer Brot.“
So deutlich hatte das uns noch keiner gesagt, aber das zwischen gemeldeter Arbeit und geleistet eine Lücke klaffen musste wussten wir, seitdem uns einer erzählt hatte, wie es in der Gießerei zuging, wenn die Norm nach der Schicht abgerechnet wurde. Nach der Zählung verschwand dort oft ein Gussstück unter dem Formsand und kam der nächsten Schicht dann zugute.
Aber das, Soll galt ja nicht nur für uns und alle in irgendeiner Fabrik oder Kolchose. Es galt eines Tages auch für das Lager, das unbedingt zum 1. Mai eine Kulturbaracke haben sollte. Und in der Tat es wurde zügig dran gearbeitet und zum 1. Mai konnte der Rohbau als fertig gemeldet werden. Dabei aber blieb es nun; fertig gebaut wurde nicht und wenn irgendwo Material fehlte, so hieß es: „dawai Kulturbarak“. Das heißt nun nicht, dass man nichts von Kultur wissen wollte. Die Chöre im Lager, der deutsche und der japanische, wurden von der Lagerleitung gefördert. Die Japaner, etwa auch 4000 Offiziere aus Garnisonen in Korea brachten viel mit, u. a. eine deutsche Augustinausgabe, die für uns Theologen von Interesse war. Aber auch ihre feste Haltung den Russen gegenüber imponierte uns, so weigerten sie sich von der Lagerleitung eingesetzte Vorgesetzte anzuerkennen, sondern gehorchten allein ihren militärischen, lächelnd setzten sie die viertelstündige Pause durch, obwohl sehr zurückhaltend schlossen einige feste Freundschaft mit Leuten von uns; so besteht eine solche noch mit Albrecht Röcker. Unter Kultur lief bei der Lagerleitung vermutlich auch alles, was an Vorträgen von Fachleuten gehalten wurde, möglicherweise auch unsere Gottesdienste. Die Predigten mussten vorher zur Genehmigung eingereicht werden, was in der Regel geschah. Fritz Garnbacher allerdings notierte in seinem Tagebuch, dass am 15. Sept. der Gottesdienst von Gerhard krause verboten wurde. Grund: Die Gliederung in „völkische Wiedergeburt“ u. 2 . Lied: „Wach auf, Wach auf, du deutsches Land“, an dem sich ja heute noch Leute stoßen, weil sie es falsch interpretieren. Wie sollten es die Russen damals richtig verstehen, nicht national, sondern religiös. Von diesem Kommando in Mitschurinsk, das lt. Fritz F. mit meinem „Rausfliegen aus der Schneiderei“ am 29. Juli begann und am 25. Oktober endete, ist mir noch die Szene in Erinnerung, die mir in der Folge, etwa 9 Monate Aufenthalt im Lazarett einbrachte.
Wir hatten uns an einem Sonntag geweigert zu arbeiten, wir vier aus M. Die drei jüngeren, weil sie sich auf irgendwelche Offiziersrechte beriefen, die mir zwar nicht stichhaltig schienen, so dass ich betonte: als Pfarrer und Christ arbeite ich nicht am Sonntag. Die Reaktion der andern Seite war die, dass man uns unter Stößen mit dem Gewehrkolben in einen von der intensiven Sonnenbestrahlung überhitzten Raum sperrte. Der Schweiß lief uns in Strömen vom Körper, wir verlangten Wasser, das uns schließlich in einem weißem Emailleeimer brachte. Es war glasklar und schien einwandfrei zu sein, war es aber nicht, wie ich in der darauf folgenden Zeit bald merkte. Ob die Tatsache, dass ich den schönen Weizen, den wir bei einem Ernteeinsatz - er lag ungeschützt auf bloßer Erde - uns genommen hatten, unverdaut wieder von mir gab etwas damit zu tun hatte, weiß ich nicht. Aber dass ich Durchfall bekam und ein „Prolapsus ani“ schließlich von der erschrockenen Ärztin dann nach der Rückkehr festgestellt wurde, hatte etwas mit der Ruhr zu tun, die mich nach einem Monat Lagerlazarett, dann für längere Zeit ins Waldlazarett brachte.
Für viele verband sich der Name „Waldlazarett“ mit der Hoffnung auf baldige Heimkehr; das wünschten mir nun auch meine Freunde, aber es hat damit noch gute Weile gehabt. Auch für die beiden andern Pastoren im Waldlazarett ging ihre Rechnung nicht auf. Sie hatten versucht, sich arbeitsunfähig zu hungern, was dem einen die Ärzte übel nahmen. Er ist sehr viel später als wir erst nach Hause gekommen, aber vermutlich aus anderem Grund.
Der andre erkrankte an Lungentuberkulose. Wir andern (Pastoren und Mitglieder der Bibelkreise) versuchten ihm zu helfen, indem wir ihm täglich Milch zukommen ließen, für deren Erwerb wir alles verkauften, was sich zu Geld machen ließ oder als Tauschobjekt dienen konnte. Ich gab die schöne Pelzweste hin, die mir Albrecht Röcker geschenkt hatte, weil ich viel fror; er war auch eine Zeitlang im Waldlazarett wegen einer Knöchelverletzung.
Und dann geschah etwas, es war Adventszeit, was wir nicht erwartet hatten, in einem sowjetischen Militärlazarett. Obwohl mir schon bei der Arbeit am Deich, Kinder versichert hatten: „Wir nicht Kommunisten, wir Christen.“, als wir auf der andern Seite des Flusses ein Brautpaar zur einzigen Kirche gehen sahen, war auch ich überrascht, dass auffallend oft Schwestern unser Zimmer betraten, manchmal still wieder hinausgingen, dann aber auch sich etwas zuflüsterten, wobei uns klar wurde, worum es ihnen ging: Sie wollten das Transparent sehen, das ich um die kleine Öllampe herum gemacht hatte. Mit Hilfe meiner Buntstifte und einiger Blatt transparenten Medizinpapier, hatte ich für uns die drei Szenen: Geburt, Hirten und Weise dargestellte.
Als ich das machte, hatte ich nicht geahnt, dass diese kleine Weihnachtspredigt auch die jungen russischen - Mädchen erreichen würde, eine nannten die anderen „schesch korowa“ (sechs Kühe), sie war eine Bauerntochter, im riesigen Sowjetreich hatten sich offensichtlich, wohl hinter Moor und Wald noch Kulaken halten können. Übrigens Predigen! Sonntags hatte ich mir immer in meinem kleinen Neuen Testament, das ich durch alle Filzungen gerettet hatte, den Predigttext des Tages aufgesucht und gelesen. Das blieb den andern nicht verborgen, die mich schließlich baten, es doch laut zu tun, so habe ich dann Sonntag für Sonntag Gottesdienst gehalten, zu dem auch aus andern Stuben der eine oder andere kam. Die Ärzte sagten nichts dazu; auch vom Chefarzt hörten wir kein nein. Er war Jude, ließ uns aber nicht entgelten was an Juden übles getan wurde; sagte wohl auf die Frage warum: „Ich weiß zu unterscheiden, im Übrigen ich habe in Heidelberg studiert.“ Die russischen Ärzte waren sichtbar bemüht, nicht nur äußerlich korrekt, sondern sie setzten sich mit ganzer Person für die ihnen anvertrauten Kranken ein, auf die Gefahr persönlicher Nachteile hin. So besorgten sie Medikamente aus der Stadtapotheke, was verboten war, und bemühten sich um Diätverpflegung. Mit großer Dankbarkeit denken viele, nicht nur ich, an Fr. Olga Schulkowa, die Stationsärztin der Inneren, Ihr Assistenzarzt war, soweit ich mich mich erinnere, Dr. Wex, ein Chirurg aus Stettin. Kurzum, Ärzte und Schwestern taten was sie konnten, und das unter Verhältnissen, die man sich, wenn man nicht Ähnliches erlebt hat, kaum vorstellen kann. Ich lag auf der Inneren, in einem Raum mit 19 Anderen. Rechts und links von einem sehr schmalen Gang befand sich je eine Bretterpritsche, auf der 10 Kranke liegen sollten, doch war ein gleichzeitiges Liegen aller auf dem Rücken nicht möglich; nur in der Seitenlage war für alle Platz. Sehr bald hatten wir uns alle Hüftknochen und Steiß aufgelegen, so dass eine ungeschickte Bewegung des Nachbarn Schmerzen bereitete. Ich erinnere mich, dass wir deshalb baten, einen Sterbenskranken wieder aus unserm Zimmer zu nehmen, weil er sich ständig hin und her warf, und als ich am Sonntag unsre Andacht hielt, in großer Angst meinte, es sei seine Beerdigungsrede. Auch wir andern hatten Depressionen zu überwinden, versuchten dies aber, indem wir uns beschäftigten oder einander mitteilten, wie unser Leben vor dem Krieg gewesen sei und was wir nach der Heimkehr zu tun gedächten. Da war der Bauer, der uns Ratschläge für eine Kleintierhaltung gab (Gänse und Kaninchen); vom Rennreiter erfuhren wir, wie er eine gewisse Diät streng einhalten musste, um fit und nicht zu schwer zu werden; dem Prinz von Ahrenberg hörten wir gern zu, wenn er, ein wenig begüterter Spross eines fürstlichen Hauses, vom Leben und Treiben seiner Kaste berichtete. Er war der weitaus Älteste unter uns und gesundheitlich schlecht dran. Wir bedauerten ihn, denn schon etliche male hatte er am Tor gestanden (Abmarsch nach hause) und immer wieder in letzter Minute hören müssen: „nasad“ (zurück). Warum wusste er nicht, wahrscheinlich war er für die Sowjets seines „Standes“ wegen wertvoll. Und dann war da für kurze Zeit ein junger Leutnant auf unsrer Stube, der von seinem Vetter in Mailand erzählte, einem Bankkaufmann, da klingelte es bei mir und ich fragte: „Heißt er etwa Kurt Range? Ja, sagte er, woher wissen sie das?“ Nun, dieser junge Offizier war also ein Vetter von Kurt Range, mit dem ich mich gut verstand, der ein Neffe von Tante Hedwig im Stift war. Gravierender war aber das Fehlen von guten Medikamenten. So bestand eine Behandlung meiner Ruhr lange Zeit nur in der Ernährung mit Reis, aber das führte zu keinem Erfolg. Erst als im Frühsommer 47 ungarische Ärzte ins Lager gekommen und Sulfonamide mitgebracht hatten, konnte einer Behandlung meiner Ruhr damit erwogen werden. Weil ich inzwischen auf der Schippe stand, wie man sich damals ausdrückte, d.h. nach 6 Monaten Durchfall nur noch, Haut und Knochen war, nahm ich das Risiko in Kauf, der Sulfonamitstoß könnte im Blick auf meine kranke Leber für mich tödlich sein. Es ging gut, der Durchfall hörte auf, ich begann mich zu erholen. An baldige Heimreise war allerdings nicht zu denken, es hatte sich doch zu sehr herumgesprochen, in welch elendem Zustand Männer aus sowjetischer Gefangenschaft heimkehrten. So sollte ich mich erst erholen, wurde „3“ (krank bzw. halbarbeitsfähig) eingestuft ins Lager zurückgebracht. Noch einmal also war ein russischer Winter zu überstehen. An Einzelheiten erinnere ich mich kaum, nur dass ich einmal im Lager als Posten beim Verpflegungsbunker eingesetzt worden war. Es war ein harter Winter. Schon nach zwei Stunden, in denen man ja hin und her ging, waren wir bei der Ablösung nicht im Stande den Pelzmantel allein auszuziehen, den wir noch über der Wattekleidung trugen, so steif waren unsre Hände trotz dicker Handschuhe. Es waren oft unter 30 Grad. Im neuen Jahr aber war es dann doch so weit. Ein Heimkehrertransport aus Sibirien sollte ganz plötzlich durch 300-400 „Dreier“ aus Morschansk aufgefüllt werden. Glücklicherweise war ich nicht zu einem Außenkommando abgestellt, als die Zusammenstellung mit den üblichen Prozeduren vor sich ging. Am 26. März - nach einer Tauwetterperiode hatte es noch einmal stark gefroren - schlitterten wir buchstäblich bei 28 Grad minus zum Bahnhof, auf dem Kopf den Strohsack, in der Hand die wenige Habe, die uns eine letzte „Filzung“ gelassen hatte, und konnten nach der üblichen Verzögerung die Viehwaggons beziehen, die man mit je einem Kanonenofen ausgestattet hatte. Allerdings mussten wir uns Brennmaterial erst „besorgen“. Relativ schnell waren wir dann in Frankfurt/Oder, wo wir aus dem sowjetischen Lager ins deutsche überstellt wurde. Bei Aushändigung des Entlassungsdokuments hatte man uns alles Gute gewünscht und erklärt, wir seien nun voll rehabilitiert, weil wir ja „wieder gut gemacht“ hätten. Aber so ganz stimmte das mit der Rehabilitation deutscherseits doch nicht. Während die ehemaligen Mannschaftsdienstgrade sofort nach Hause fahren durften, musste ich erst nach Ludwigslust fahren, um mich da registrieren zu lassen und kam bei den damaligem Bahnverbindungen am nächsten Tag über Rostock-Stralsund nur bis Greifswald, wo ich auf dem Bahnhof in der „Rote Kreuz-Baracke“ schlafen durfte, sodass ich wohl erst am 2. Ostertag in Anklam war.
Wenn ich an die Zeit der Gefangenschaft zurückdenke, so habe ich immer gesagt: Ich möchte es nicht noch mal erleben, aber missen möchte ich diese Zeit auch nicht.