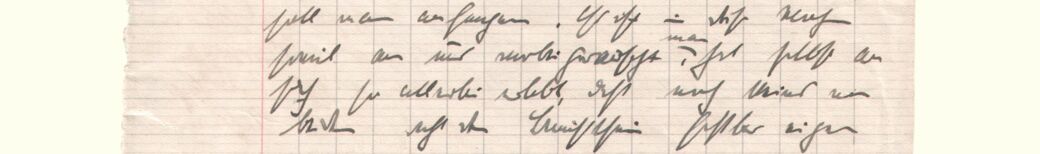Rückblicke
Nach der Rückkehr - „Erfahrungen“ mit der jungen DDR
Nun war ich also wieder zuhause und hatte doch kein Zuhause. In Usedom taten zwei ostpreußische Pfarrer Dienst; Anneliese wohnte zwar im Pfarrhaus, aber irgendetwas stimmte nicht. Bischof und Konsistorium hatten mich zur Heimkehr beglückwünscht, mir einen längeren Erholungsurlaub gewährt und dann nach einiger Zeit die Pfarrstelle Nadrense bei Penkun angeboten. Warum, fragte ich mich.
Auf ärztlichen Rat hin hatte ich mich für eine Stadtpfarre entschieden und jetzt - immer noch nicht gesund - sollte ich eine Landpfarre in ungünstiger Lage antreten. Warum? Nach und nach erfuhr ich den Grund. Meine junge Frau hatte sich, wie man so sagt, als Pfarrfrau unmöglich gemacht, indem sie sich zu öffentlich den Hof machen ließ, zunächst von deutschen Offizieren und später von russischen. Sie hat sich vermutlich nichts weiter dabei gedacht, und sich mit russischen Offizieren gut stellen, war unter bestimmten Umständen eine Überlebensfrage, zumal wie ich erfuhr, das Konsistorium ihr wenig finanziell beistand. Kurzum nach den damaligen Maßstäben lag ein Makel auf ihr und damit auch auf mir. Wir wollten aber einander nicht schaden und willigten in die Scheidung ein, zumal eine eheliche Gemeinschaft nicht bestanden hatte. Sogleich nach der Trauung war ich wieder zur Truppe gereist und jetzt erst wieder heimgekehrt. Dies geschah meinerseits nach Konsultation mit Superintendent und Bischof. Eine Schuldzuweisung wurde in der Begründung der Trennung vermieden.
Inzwischen hatte Superintendent Lic. Scheel in Anklam mich gebeten, doch nach Kagendorf zu gehen, das dringend einen jüngeren Pastor brauche. Und in der Tat Kagendorf war schlecht dran. Das Pfarrhaus war abgebrannt, Pf. Ruchholz war noch während des Krieges nach Filehne versetzt worden und dort umgekommen. Zur Pfarre gehörten 8 Dörfer mit drei Kirchen und drei Kapellen sowie 7 Friedhöfe. Die Seelenzahl war durch Flüchtlinge aus Hinterpommern und Ostpreußen auf über 3000 gewachsen. Zum 1. Juli wurde ich kommissarisch mit der Verwaltung beauftragt und zum 1. Oktober berufen. An Amtshandlungen war kein Mangel. Die Amtskleidung wurde nach und nach beschafft (meine Sachen aus Altenhagen waren samt Fahrrad nicht mehr vorhanden). Meine Mutter hatte vorsorglich eine Jacke schwarz gefärbt und ein Fahrrad wurde in der Werkstat von Bubi (Kurt Becker, der als erster wieder in Anklam war) zusammengebaut. Bald bekam ich von der Patengemeinde Petri-Hamburg ein schickes Fahrrad, um das um das die jungen Leute mich beneideten.
Ich tauschte es dann gegen ein älteres, stabileres ein, weil ich mir gern einen Hilfsmotor anbauen wollte, was bei dem westlichen Rennrad nicht möglich gewesen wäre. Das das auch noch nicht die letzte Lösung war, sei kurz erwähnt, schließlich hat mir Kurt ein Leichtmotorrad besorgt, das leider oft bis Neukosenow angeschoben werden musste, aber doch eine Hilfe war, waren doch die Entfernungen im Kirchspiel beträchtlich, zumal z. B. Rossin oft nur über Ducherow zu erreichen war.
Genauso dringend war die Besorgung einer Wohnung. "Zuzug bekommen sie nicht, einen Pastor brauchen wir nicht." hatte mir zwar zunächst der Bürgermeister erklärt, dann aber doch den Zuzug in ein möbliertes Zimmer beim Kirchenältesten in Brandenburg gestattet. Da war es ein "Glück", das sich sein Nachfolger Gerhard Lewerenz daran erinnerte, dass er einmal auf dem Gymnasium in Anklam zu meiner Pfadfindergruppe gehört hatte. Er hatte auch keine Wohnung, so beschlossen wir je zur Hälfte den Lehmstall auf dem Pfarrhof zu einer Wohnung für uns auszubauen. Diese Kooperation erleichterte den Baubeginn, von dem Lewerenz allerdings bald zurücktreten musste. Das war jedoch ein Vorteil für mich, bekam ich doch nun nach und nach nicht nur links Amtszimmer und Schlafzimmer usw., sondern auch rechts Gemeinderaum und Katechetenraum. Gleichzeitig fand ich Helfer, die dafür sorgten, dass die Kirchen und Kapellen wieder benutzbar wurden (Fenster und Dächer wurden geflickt und die gründliche Instandsetzung der Kirche in Rossin in Angriff genommen, die seit 1939 baupolizeilich geschlossen war. Im Zuge der dadurch unumgänglichen Behördengänge, konnte ich mich immer wieder einmal - wenn auch kurz - bei den Eltern in Anklam sehen lassen, wofür ich Heute noch dankbar bin, verloren wir doch ganz plötzlich am 3. Jan. 49 unsre Mutter durch einen Darmverschluss, der zunächst nicht erkannt und dann von dem Arzt im Krankenhaus nicht operiert wurde, weil er sich eine Operation vermutlich nicht zutraute. An Schwierigkeiten fehlte es nicht. Nicht nur in diesen äußeren Dingen, auch auf das Amt selbst und die christliche Botschaft hin, war bei vielen abwartende Skepsis spürbar, teils, weil einige doch sehr die nationalsozialistische "Heilslehre" sich zueigen gemacht hatten, andre, weil die Theodizee-Frage sie um trieb: Warum musste ich das erleben und erleiden, ich habe mich doch zu Gott gehalten? Doch, weil sie wussten, dass auch ich zu tragen hatte und jüngst wieder, öffneten sie sich bereitwillig im Gespräch und ich durfte erleben, wie stark Trost und Wegweisung aus Christi Worten kommt, weil sie nicht leere Worte sind (Mathäus 18, 20)
Dass ich 1948/49 60 Konfirmanden und 58 Vorkonfirmanden hatte zeigt, dass man durchaus noch von volkskirchlichen Verhältnissen sprechen konnte. Gut besucht waren nicht nur Advents- und Passionsandachten, die ich auch in den Außendörfern hielt, sondern auch Bibelstunden und Jugendstunden. Doch zeigte es sich leider schon 1949, dass meine Leber noch recht krank war. Pfarrkrankenkasse, Sup. Krause-Spantekow und Sup. Scheel bemühten sich um eine Kur für mich in Mergentheim, nachdem Arzt und Kreisarzt eine solche Heilbehandlung dringend empfohlen hatten.
1950 war dann ein ganz besonderes Jahr. Am 20. Januar heiratete ich eure Mutter, Gerda Lode, damals Leiterin des Kinderheims in der Hospitalstraße. Getraut hatte uns Lic. Scheel in der Marienkirche, gefeiert wurde bei Ladricks, denn die Wohnung in Kagendorf im Pfarrstall war erst im Werden. Für unsre Verwandten und Freunde war es wohl das erste Fest nach dem Krieg, das sie mit uns feierten. Alle hatten zum gelingen beigetragen und uns beschenkt, auch die Kagendorfer hatten uns wohl zu diesem Anlass die drei jungen Legehühner geschenkt, die Troll aus seinem Futternapf fressen ließ, während er alle andern Hühner wütend verjagte. Nun hatte ich wieder ein Zuhause und war glücklich, dass mich jemand begrüßte, wenn ich nach den vielen Amtsgeschäften heimkehrte.
Im Sommer durfte ich dann die schon lange vorbereitete Kur in Mergentheim durchführen, wo ich alte Freunde aus der Gefangenenzeit begrüßen konnte und neue Freunde gewann (Schwester Elisabeth Frenz). Die Behandlung im Haus Schwaben war die beste, die Ärzte forderten aber dringend eine Wiederholungskur im kommenden Jahr, die auch wahrnehmen durfte. Aauch 1953 fuhr ich noch einmal von Kagendorf aus nach Mergentheim wo mir wieder die Ärzte ganz dringend zu einer anderen Pfarrstelle rieten. Das dritte besondere Ereignis war die Wiedereinweihung der Kirche in Rossin am 8. Oktober. Endlich konnten Gottesdienste und Jugendstunden in der Kirche stattfinden und die Benutzung des Schulraumes, den uns der Nachfolger von Kantor Diedrich nur widerwillig jeweils überlassen hatte, entfiel.
Im Zuge der Restaurierung der Kirche besuchte uns mehrmals der Bildhauer Max Uecker aus Greifswald, der das kl. Relief von Elisabeth sah und mich aufforderte, doch mal etwas Größeres zu machen, so entstanden dann nach und nach jeweils als Meditationen meine Holzplastiken zumal seitdem ich bei Besuchen in Greifswald die aus mancherlei Anlässen (Bauten, Tagungen) gemacht werden mussten, mir von Max Uecker die Handhabung der Eisen (er hatte mir eine ganze Garnitur geschenkt) hatte zeigen lassen. Bis zur Abfahrt des Zuges war ich gern bei ihm in seinem Atelier.
Außer der Kirche in Rossin kam auch der Kirchturmbau in Kagendorf zur Vollendung, in Dargibell konnte in der Kapellenruine ein Teil abgetrennt und überdacht werden so dass eine kleine Kapelle entstand, für die der Architekt Buchholz neue bequeme Kirchenbänke hat bauen lassen und eine Aufhängung für die alte Glocke, die bis dahin in Kagendorf hatte benutzt werden können. In Rosenhagen hatte schließlich, diesmal auf der Orgelempore eine Winterkirche ausgebaut werden können. Doch nun musste schon ans Abschiednehmen gedacht werden. Die Ärzte hatten ja Recht, die kranke Leber vertrug die Strapazen der kalten Kirchen, der zugigen Friedhöfe, der weiten Radfahrten nicht. Es fiel uns nicht leicht, uns vom gemütlichen Haus, von den vielen Menschen, die uns zugetan waren, zu trennen. Eine leichtere Pfarre mit genügend Wohnraum - wir waren inzwischen schon eine große Familie - zu finden war nicht einfach. Erschwerend war auch die Tatsache, dass ich mein "Kranksein" bei den Bewerbungen nicht verschwieg. Auch sollte es sicher Dersekow sein, wo wir dann zweiundzwanzig Jahre waren. In Barth verhinderte der plötzliche Tod von Sup. Podzus, der in Kenz gewohnt hatte, meine Wahl an Marien-Barth. Die Superintendentur sollte wieder nach Barth. In Stralsund entschied das los gegen mich.
Dersekow war nun eine leichte Stelle. Mein Vorgänger Lic. Schott hatte ohne große Schwierigkeit neben dem Pfarramt auch sein Lehramt an der Universität verwalten können; die offiziellen Angaben sprachen von zwei Predigtstellen (es waren aber mehr, wenn man seinen Dienst ernst nahm). Weitere Pfarrdienste waren besetzt. Der Hauptlehrer war Kantor und leitete einen Kirchenchor, eine Katechetin war für die Christenlehre zuständig, ein Kirchendiener betreute fleißig und treu Kirche und Friedhof; das galt für einen zweiten Kirchendiener auch für Pansow. Der Gemeindekirchenrat bestand aus meist kirchlichen aktiven Bauern und Neubauern. Das Patronat der Universität ruhte allerdings weitgehend; also in der Tat eine leichte Stelle, zumindest für die ersten Jahre. Die Verwaltung der Vermögenswerte der Pfarre, Gebäude und Äcker aber, kosteten schon sehr bald viel Zeit und Mühe.
Alles, was zu einer Landpfarre gehörte, an Gebäuden und Land, war noch in kirchlichem Besitz; zwei Kirchengebäude, das Pfarrhaus, die Küsterei, das Kirchendienerhaus, das Pfarrwitwenhaus und die Pfarrpächterei. Bis auf die Kirchen, das Pfarrhaus und das Wohnhaus der Pfarrpächterei waren es Fachwerkgebäude unter einem Rohrdach; 200 bis 300 Jahre alt. Dass hier ständig Reparaturen anfielen, braucht nicht weiter ausgeführt zu werden. Wie schwierig aber solche Reparaturen durchzuführen waren, kann sich heute niemand mehr vorstellen; wie lange es dauerte Handwerker willig zu machen, oft mussten, Älteste und auch ich als Helfer uns zur Verfügung stellen. Und wie schwer es war Material zu beschaffen und heranzuschaffen! Dazu kam, dass auch die "Kirchenhäuser", wie alle anderen, voll gestopft waren mit Flüchtlingen, die nach und nach Ansprüche stellten. Solche Ansprüche waren oft berechtigt, oft auch ärgerlich. Zwei fälle im Pfarrwitwenhaus, in dem 6 Familien untergebracht waren, sind mir in Erinnerung. Ein kleiner Anbau nur 180 cm Deckenhöhe, war geräumt worden, da bat die Familie ihn mit benutzen zu dürfen, was ihr selbstverständlich genehmigt wurde. Sie ließen dort aber dann einen ihrer Söhne schlafen und verlangten den Raum mit einem Ofen zu versehen. Was wir unter Zwang tun mussten. Der zweite Fall, wieder im Pfarrwitwenhaus. Die Mieterin wollte moderne Fenster haben, die nach alter Art gegliederten gefielen ihr nicht mehr. Doch nachdem der Bauausschuss der Kirchgemeinde ablehnte, weil die Fenster im Holz noch gesund waren, öffnete sie bei stürmischem Wetter diese Fenster (die nach außen aufgingen) ohne sie festzuhaken, so dass sie der Sturm zerschlug. Weil es über 22 Mietsparteien waren, und das in uralten Gebäuden, war das für mich eine große Last, zumal ich als Pastor in vielen Fällen gern geholfen hätte, es als Verwalter des Pfarrvermögens aber nicht durfte. Auch der Landbesitz bereitete viel Kummer. Bis auf 60 Morgen, die zur Pfarrpächterei gehörten, war er auf ca. 20 Pächter verteilt. Doch kamen natürlich immer wieder Kündigungen von Seiten der Pächter vor, dann musste sofort ein Nachfolger gefunden werden, denn sonst fiel ein Minus im Etat ein. Auch die pastoralen Verhältnisse verschlechterten sich nach und nach. Der Hauptlehrer und Kantor gab dem Druck seiner Vorgesetzten nach und kündigte Juli 1958 sein Kirchenamt - er tat es sicher nicht gern. Die Katechetin ging zu ihrem Vater nach Schaprode, um bei der Pflege ihrer Mutter zu helfen. Schon vorher war uns der Zutritt zu den Schulen in Klein Zastrow und Hinrichshagen verwehrt worden, in denen laut Aufsiedlungsrezess der Kirchengemeinde ein Raum für Gottesdienste festgeschrieben worden war.
Schließlich legte auch der Kirchendiener sein Amt nieder. Für den Kirchenchorleiter fand sich kein Nachfolger, ich selber war ja ungeeignet dafür. Für den sonntäglichen Gottesdienst konnte ich Frau Hildegard Jantzen gewinnen, die Frau eines ehemaligen Gutsbeamten. Sie konnte Klavierspielen und weil auch Eure Mutter das konnte musste auch diese immer wieder einspringen, was bei all den andern Aufgaben, die ihr nun neben der Bewirtschaftung des großen Gartens zufielen, eine schwere Belastung war. Auch der Kirchendienst musste nun ja mitgemacht werden und, weil die Christenlehre von Seiten der Schule immer mehr behindert wurde, galt es auch die Kinder im Pfarrhaus zu beschäftigen, bis Katechetin oder ich sie übernehmen konnten. Trotz allem nahm eure Mutter willig die zusätzliche Belastung auf sich, die Helferrüsten und Konfirmandenrüsten, die jeweils einen ganzen Tag dauerten, bedeuteten. Die Frauen (eure Mutter, Frau Schwewe und oft noch eine weitere Helferin) meisterten die Verpflegung von oft über 30 Personen meisterhaft, auch einmal, als der Eintopf so gut schmeckte, dass es für einige fast nicht gereicht hätte.
Die Helferrüsten (analog der "leadership - arbeit" in den USA) von Sup. Wilm angeregt und im team mit ihm und anderen Pastoren aus Greifwald durchgeführt, bewährten sich in vielfacher Weise. GKR und Gemeinde Beirat, und darüber hinaus Männer und Frauen, denen Kirche und glaube an Christus etwas bedeutete, lernten sich in guter Gemeinschaf besser kennen und empfingen "Zurüstung" für ihr Christsein in ihrem "Lebensraum". Das wirkte sich positiv und segensreich aus, als es immer schwerer wurde, in den Dörfern ohne kirchlichen Raum (die uns im Rezess zugesagten Räume in den ehemaligen Schlössern in Kl. Zastrow und Hinrichshagen waren uns ja genommen worden) Christenlehre und Gottesdienst zu halten. In diesen Dörfern fanden sich insbesondere Frauen gegen alle Bedenken bereit - obwohl es der Polizei gemeldet werden musste - ihre Wohnung dafür zur Verfügung zu stellen (nach einiger Zeit durften "Anmietverträge " abgeschlossen werden, so dass das ständige Anmelden bei der Polizei entfiel). Meine Gesundheit ließ auch in Dersekow weiterhin zu Wünschen übrig, wenn sich auch im Blick auf die Leber eine wesentliche Besserung einstellte, zumal ich noch einmal vor der Mauer l956 nach Mergentheim zur Kur fahren durfte, wofür Prof. Müller und das Hilfswerk gesorgt hatten. Doch machte Herz und Kreislauf Schwierigkeiten, so dass man eine Mandeloperation für wichtig hielt. Ich war schon 50, hatte eine etwas vergrößerte Mandel, durfte dann auch noch 1960 nach Kransbach-Klais zu einer Herzkur in die schönen Alpen - ein Ausflug mit dem Bus ins Karwendelgebirge und nach Bozen über Innsbruck war auch dabei. Ich musste dabei an meinen Vater denken, der von seinem Aufenthalt in Tirol oft mit großer Freude gesprochen hatte. Übrigens Kranzbauch liegt ja in der unmittelbaren Nähe von Garmisch-Patenkirchen, der Heimatregion der "Much-Familie". Eine Wiederholungskur in Stützerbach/Thüringen war dann 1964 nur dank persönlicher Beziehungen von Adolf Zeuner, meinem Amtsbruder und Freund aus der Gefangenschaft, möglich, denn als "Privatpatient" und dazu als Pfarrer war ich nicht einzuplanen.
Doch noch einmal zur kirchlichen Lage im Kirchspiel Dersekow. Bis zur Zwangskollektivierung und der Mauer war weitgehend kirchliche Arbeit möglich, sogar die Christenlehre konnten wir, selbst nach Fortfall der Räume in den Schulen (ehemaligen Gutshäusern), wenn auch hin und wieder durch die Schule behindert durchführen; es waren ja noch nicht alle Lehrer auf die Linie der SED festgelegt. Selbst die Attacke auf die Konfirmation durch die mehr oder weniger zwangsweise eingeführte Jugendweihe konnte durch eine Neuordnung der Konfirmation in Dersekow abgewehrt werden. Ich war im Konfirmationsausschuss der Landessynode und hatte mich mit der Historie der Konfirmationspraxis nach der Reformation befasst und dabei aus den Pfarrakten von Kagendorf und Dersekow festgestellt, dass noch lange Zeit Konfirmation in unsrer Landeskirche zweierlei war. Einmal die Einsegnung, wenn die Kinder den Katechismus konnten und später, oft erst vor der Trauung, die Zulassung zu den Sakramenten, insbesondre dem Heiligen Abendmahl. Beides war an kein Alter gebunden, so wurden schon 10-jährige konfirmiert und erst 20-jährige bekamen die Zulassung zu den Sakramenten. Ich hielt mich also nicht mehr an das Alter von 14 Jahren, das ja nur des anschließenden Schulabschluss wegen eingeführt worden war, sondern konfirmierte ein Jahr früher. Damit kam es am Palmsonntag nicht zu einer Kollision mit der Jugendweihe, die ich wie die Eltern als eine reine Schulangelegenheit betrachtete. Und es war gut so, denn ein Entweder / Oder hat überall zum Sieg der Jugendweihe geführt, denn nur wenige Eltern wollten das Risiko eingehen, dass das Verweigern der Jugendweihe die Ausbildung ihrer Kinder gefährdete. Bald verlegten wir in Dersekow den Konfirmationstermin auf die Pfingstzeit, beließen die Prüfung um Ostern und ich benutzte die Zwischenzeit zur Sakramentsunterweisung (analog alter Ordnung) und hielt: einmal je Woche Sakramentsrüsten, zu denen ich die ganze Gemeinde einlud. Für die Konfirmanden aber war es obligatorisch, auch für ihre Eltern, womit ich es für die Väter leicht machte, die sonst fürchteten sich sagen lassen zu müssen "fromm" geworden zu sein. Sie hatten nun ein Alibi, dass galt übrigens auch für jede Teilnahme an Beerdigungen und zwar auch an der Nachfeier, bei der sich die Geister schieden.
Als dann aber Dersekow LPG wurde und "sozialistisches Musterdorf" werden sollte, wurden mehr und mehr auch einzelne Gemeindeglieder auf ihre Kirchenzugehörigkeit angesprochen. Bei Eltern, die ehrgeizige Ziele mit ihren Kindern hatten, blieb das nicht ohne Wirkung. Andre konterten. So ein junger Bauer, dem man sagte: "Na, deine Tochter geht zum Pastor (Konf. Unt. ), das solltest du nicht zulassen." Der aber antwortete: "Das geht euch gar nichts an, das ist meine Sache." Und als sie gar die Kirchenälteste in Friedrichsfelde, eine alte SPD-Genossin, vor die Wahl stellten: Partei (SED) oder Kirchenälteste, da sagte sie: "Dann nehmt das Parteibuch." Sie war Witwe und hatte es schwer mit drei Rindern die Siedlung zu halten und musste Schikanen fürchten.
Nicht überall hatte sich trotz massiven Drucks und Zwangs die LPG Typ III durchsetzen können, so hielt sich, besonders auch in Klein Zastrow eine LPG Typ I (eigene Viehhaltung) und die Mitglieder machten aus ihrer "Kirchlichkeit" keinen Hehl - die Hälfte der hessischen Altsiedler waren allerdings nach der Zwangskollektivierung in ihre Heimat zurückgekehrt. So stellte mir hin und wieder die LPG I ihr Büro am Sonntag für Gottesdienste zur Verfügung. Aber das musste ja nun unterbunden werden, so wurde dem Vorsitzenden deutlich gesagt: "Du musst als Vorsitzender nun auch bald in die Partei (SED) eintreten." Er darauf: "Ja, wenn das sein muss, dann muss ich mir das ja ernsthaft überlegen." Und ein paar Tage weiter erneut: "Na, trittst du nun ein?" Er darauf: "Sagt mal, kann man denn auch in zwei Parteien sein? Ich bin ja nun schon in die CDU eingetreten." Dazu ist zu sagen, bei allem, was jetzt von SED-Hörigkeit der Ost-CDU gesagt wird, an der Basis wurden christliche Belange vertreten, in Zeitung und Verlag und besonders da, wo nach bewusster Taktik auch in einem Dorf ein CDU-Bürgermeister sein sollte, war vieles möglich (etwa Druck eines Gemeindeblattes), wovon andre nur träumen konnten. So sagte mir einmal der Bischof: „Aber mein Schwiegersohn hat da keine Schwierigkeiten!“ Ich denke Bischof Krummacher hat danach die 2. Taktik der SED durchschaut. Oben: Scheibchenweise Freundlichkeit; Unten: Vermehrter Druck auf die Masse der Gemeinden und zwar auf die einzelnen christlichen Gemeindeglieder. Die Entspannungspolitik des Westens - ich will mir kein Urteil erlauben, ob nötig oder nicht - hatte der DDR-Bevölkerung u.a. deutlich gemacht, dass sie noch Jahrzehnte mit und unter dem SED-System würde leben müssen. So sah man zu, wie man mit dem System auskam und vermied Kontakte mit der Kirche, weil diese ganz offensichtlich hinderlich für berufliches Fortkommen war.
Nun gab es in allen Dörfern des Kirchspiels bewusst kirchliche Familien, die diesem Trend etwas entgegensetzten, indem in ihren Häusern Gottesdienste gehalten und Nachbarn zu den Familiengottesdiensten mitgenommen wurden, die wir häufig hielten, auch wohl zu den Abenden der Volksmission, die fast jährlich Herr Bohl hielt, auch zu den Kirchenmusiken u.a. Auch Christenlehre war so in Dersekow noch möglich, weitgehend dadurch, dass unsre Kinder ihre Freundinnen mitbrachten, deren Eltern sich bedeckt hielten: „Ja, wenn die Kinder wollen“.
Die Zahl der Taufen und Trauungen, auch der Konfirmanden waren jedoch auch bei uns rückläufig. Besonders wichtig waren mir nun die Geburtstagsgratulationen bei den 70-Jährigen und älteren, denen ich immer ein Verteilheft der EVA mit brachte, in der Hoffnung, dass auch die jüngere Generation mal drin lesen würde. Dass das geschah bestätigte mir eines Tages sogar der Parteisekretär der LPG unter vier Augen. Überhaupt ist zu sagen, dass nicht nur unsere Kinder oder die Kinder überhaupt- "zweigleisig" lebten (Schule / Zuhause), auch selbst von den Funktionären galt das. Viel Lehrer litten darunter, versuchten auch wohl es unsern Kindern leichter zu machen, wenn sie ihnen "Unrecht" tun mussten. Die Tatsache, dass bei all meinen Bemühungen - ich hielt schließlich an jedem Wochentag in einem Ort bzw. Ortsteil Christenlehre für mehrere Gruppen - der Rückgang nicht aufzuhalten war bedrückte mich zunehmend und wirkte sich auch negativ auf meinen noch immer labilen Gesundheitszustand aus. Ich litt unter starken Krampfzuständen im Darmbereich, so dass ich einige male während des Gottesdienst die Kirche verlassen, und wenn ich unterwegs war anhalten musste, um beim Lauf über einen gepflügten Acker mir Erleichterung zu verschaffen. Bei alledem konnte ich aber auch erfahren, dass ich immer wieder einmal für einen Menschen wichtig war. Soviel Arbeit und mühe es auch kostete Pfarrhaus und Garten einigermaßen in Ordnung zu halten, so hatten wir und oft unsre Gäste viel Freude an unserm Zuhause, zudem ja nicht nur gehörte was da wuchs an Gemüse, Blumen und Obst, sondern auch das Schaf mit seine Lämmern, die Flugenten und Egon der Zwerghahn.
Ruhestand in Anklam
Mit Gerhard Masphuhl und seiner Familie verband uns eine Gute Freundschaft. Ich hatte ihn zum Superintendent vorgeschlagen als Superintendent Wilm die Superintendentur Greifswald-Land abgegeben wollte und mich dafür vorgeschlagen hatte, was ich ausschlug, weil ich mir die seelisch-körperlichen Anstrengungen, mit den politischen Behörden verhandeln zu müssen, nicht zutraute und ich zuviel Angriffsmöglichkeiten (geschieden und ehem. Offizier) geboten hätte. Solange Gerhard Masphuhl amtierte, insbesondere zur Zeit seiner Erkrankung, hielt ich am Amt des stellvertretenden Sup. Fest, während ich das Amt des Kindergottesdienstbeauftragten der Landeskirche niederlegte, als in Dersekow Kindergottesdienst nicht mehr möglich war (etwa 1960). Bis dahin habe ich bei den Tagungen, die in Berlin stattfanden, bei Werner Schlenskas Familie gewohnt, der als Orthopäde zuerst in der Charité und später in Westberlin in eigener Praxis tätig war. Bei seinem Sohn Reinhard wurde ich Pate. Auch mein Mandat in der Landessynode (1958-69) hatte ich später aufgegeben „aus gesundheitlichen Gründen“, so offiziell, aber auch, weil ich die immer mehr den staatlichen Methoden sich angleichenden Verfahrensformen nicht für richtig hielt und es deshalb zu einer „Auseinandersetzung“ mit dem Bischof gekommen war.
Und da war da noch die Geschichte mit dem Mann aus Rostock, Gerda sagte er sähe wie ein Pastor aus, der sich erkundigte, ob wir noch Schwierigkeiten hätten. Und in der Tat, wir hatten Schwierigkeiten als er zum ersten Mal auftauchte und ich ihn am Kaffeetisch im Gespräch mit eurer Mutter antraf. Da war die Sache mit Lindemann, dem Altkommunisten, der mir gedroht und mich angezeigt hatte, da war möglicherweise auch die Absage der EOS für Ottfried und die Schwierigkeiten bei der Christenlehre. So traf ich ihn noch mehrmals am Kaffeetisch an. Ich brachte das Gespräch meist auf die grundsätzlichen Fragen, Christlicher Glaube & ¬Sozialismus, und sagte wohl einmal, gegen wahren Sozialismus wäre nichts einzuwenden, doch der real existierende habe ein falsches Menschenbild. Und dann machte es mich einmal stutzig, dass er von der Landessynode etwas hören wollte, worauf ich ihm sagte, nun das wissen sie doch, ihr Mann ist ja dabei: Obwohl es für mich feststand - aus den Erfahrungen in Sowjetischer Kriegsgefangenschaft - dass überall Spitzel waren (die kasaika im Waldlazarett) auch ich wusste, dass ich seit meiner Registrierung in Ludwigslust überwacht wurde, auch einmal Fr. Klassengenossin, deren Bruder bei der Stasi war, ihr gesagt hatte, ich weiß, dass dein Vater Hauptmann war. Kurzum, obwohl ich misstrauisch war, hatte ich den netten Mann aus Rostock nicht für einen Stasi-Mann gehalten. Als er aber nach meinen Ausscheiden aus der Landessynode nicht mehr erschien war es mir klar und ich frage mich heute noch: Was hat er aus unsern Gesprächen am Kaffeetisch gemacht und wer hat dich nun weiterhin bespitzelt. Gleich zu Beginn dieser Besuche hatte ich Masphuhl davon erzählt, aber als ich es beim Konsistorium tat, reagierte man gar nicht darauf, was mir komisch vorkam.
Doch als ich dann 65 geworden war, hielt ich es für geboten, meine Emeritierung einzuleiten, im Wissen, dass eine Emeritenwohnung schwer zu bekommen sein würde, weil sie auch für die Kinder in der Ausbildung passend sein musste. Eine Übersiedlung in den Westen aber kam nicht in Frage, weil wir unter damaligen Verhältnissen, uns von einem Teil unserer Kinder hätten trennen müssen. Da wurde in meinem Elternhaus die vermietete Wohnung frei. Auf Anraten meiner Geschwister beantragte ich für mich die Freigabe dieser Wohnung als Miteigentümer und kinderreich beim Wohnungsamt in Anklam. In einer mündlichen Verhandlung wurde der Antrag barsch zurückgewiesen. „Ob ich es denn verantworten könnte, dass eine Familie, die in einer schlechten Wohnung wohne, zu schaden käme“, so hielt mir der Vertreter des Wohnungsamtes Anklam vor. Weil ich aber meinen Antrag in Abschrift, nicht nur dem Konsistorium, sondern auch dem Rat des Bezirks zur Kenntnis gegeben hatte, war auch eine Vertreterin dieser Behörde zugegen, die mir dann riet: „Bleiben Sie dran!“ Was mir wie Hohn klang (aber wie sich heraus stellte, gut gemeint war) Ich mir damals nur dachte, oder gar erwiderte: „Wenn einer in eine Wohnung eingezogen ist, so geht er doch nicht sobald wieder raus, jedenfalls kann ich solange nicht warten.“ Es zog dann der Anführer der Kampfgruppen in die Wohnung. Ich meldete das dem Konsistorium und versuchte es noch einmal, die Vertreterin aus Neubrandenburg schien uns ja wohlgesinnt zu sein. Und das „Wunder“ geschah, nach etwa einem Jahr wurde die Wohnung uns freigegeben; ob wir es Plath zu verdanken hatten?
Dann der Umzug! Das war nun nicht nur der eigentliche Umzug mit Spediteur usw., was einigermaßen laufen sollte. Aufwendig waren die Vorarbeiten. Es sollte eine Garage für den Trabi gebaut, die alten Kachelöfen durch Außenwandgasöfen ersetzt werden. Einen durften wir erwerben, für zwei weitere wurde uns die Zulassung zugesagt, wenn sie über Genex kämen, d.h. vom Westen mit DM bezahlt würden. Wieder halfen meine Freunde (Röcker, Fricke, Farenbacher, Letz, Häußler). Die Montage der Öfen aber schien in absehbarer Zeit nicht möglich, weil die erforderlichen Verbindungsstücke für die Rohrleitung bei der Firma in Anklam nicht zur Verfügung standen; auch der Leiter der Firma, ein kirchlicher Mann - ohne „Vitamin-B“ ging sowieso nichts - durfte die vorhandenen Stücke für „Privat“ nicht verarbeiten. So startete die Familie eine Suchaktion bei bekannten Klempnern zwischen Gützkow und Luckow.
Als ich dann am 16. September mit dem PKW Weckgläser und anderes schon nach Anklam schaffen wollte, geriet ich vor Greifswald in einen Platzregen, von einem entgegenkommenden LKW sah ich etwas auf mich zu fliegen. Automatisch nahm ich den Fuß vom Gas, so traf der Gegenstand das Auto nur in Motorhöhe und prallte weg. Im immer noch strömenden Regen konnte ich den Gegenstand nicht finden, auch die Polizei, die ich von einer Baracke in der Nähe aus angerufen hatte, fand ihn nicht. Es schien zunächst nur ein Blechschaden zu sein, aber ich kam nicht mehr nach Dersekow zurück. der Motor musste erneuert werden. Meister Grade half mir das „corpus delicti“ zu finden. Es war der Sprengring des LKW-Hinterrades. Für lange Zeit war ich nun ohne Auto, doch Irmfried half aus. Am 5. Okt. war dann der Umzug, am 16. Okt. fuhr ich noch einmal nach Dersekow zur Pfarramtsübergabe. Doch Friedegard durfte noch geraume Zeit mit ihrer Familie im Pfarrhaus oben wohnen, so dass uns Dersekow noch nicht ganz „gewesen“ war.
Dann war Anklam für 13 Jahre unser Zuhause und doch nur bedingt. Der Anklamer Konvent nahm mich überaus freundlich auf. Viele kannten mich noch, alle freuten sich, dass ich bereit war, zu helfen. So wurde ich wieder Kreisarchivpfleger des Kirchenkreises sicherte in dieser Funktion die Archive von Teterin und Blesewitz, den beiden Pfarren, die nicht mehr besetzt werden sollten, entdeckte die kostbare Lutherausgabe auf dem Dachboden in Spantekow; trug die Synodalbücherei wieder zusammen, die zerstreut auf dem Dachboden des Marienpfarrhauses lag und ordnete sie wieder; ordnete das Synodalarchiv, übernahm die Beantwortung der Kirchenbuchanfragen sowie die Regie der Kirchenöffnungen und Führungen, als Martin Afhelt, der Sohn des Pf. A. nach Beendigung seines Theologie-Studiums diese Arbeit, die er begonnen hatte, nicht mehr weiter tun konnte. Für diese wichtige Arbeit verfasste ich einen Kirchenführer, den ich mit Linolschnitten versah, und den Kantor Grosch bei Rauchmann drucken ließ. „Für innerkirchlichen Dienstgebrauch“ entstanden weitere Heftchen-, über die Arkadenmalerei in Marien und Nikolai, über die Pfarrkirchen im Kirchenkreis über die Anklamer Kirchen u.a., die an Chor und Mitarbeiter verteilt wurden.
Die Kirchenöffnungen erfreuten sich großer Beliebtheit, viele Urlauber, die in Anklam eine Pause einlegten, kamen in die Marienkirche, darunter auch Ausländer und besonders Menschen aus der Tschechoslowakei, für die Jarda, Hartmuts Freund, ein ev. Pfarrer, den „Kirchenführer“ ins Tschechische übersetzt hatte. Weil ich seit meiner Studienzeit mich für Kirchengeschichte interessiert hatte - auch später Mitglied der Arbeitsgemeinschaft war - fiel mir natürlich zu den jeweiligen Gedenktagen die Aufgabe zu, Referate zu halten und Ausstellungen zu organisieren (Adelung, Bugenhagen, Hugenotten, jüdische Gemeinde, Kirchenkampf, Stadtjubiläum). Das blieb nicht unbekannt, so dass auch die Gruppe der Baudenkmalpfleger mich zur Mitarbeit aufforderte; ich tat das gern, konnte ich doch an der richtigen Stelle Belange der Kirche vertreten.
Dass ich mich weiterhin für die Bodendenkmalspflege stark machte, sei erwähnt. Wenn man mir zunächst nur widerwillig Zugang zum Archiv des Heimatmuseums erlaubte, änderte sich das, als der neue Leiter Dr. Wassermann festgestellt hatte, dass ich schon als Schüler dabei war, als das Museum gegründet worden war. Hier wurde daraufhin, besonders wieder als Herr Morgenstern die Leitung übernommen hatte, um Mitarbeit gebeten, der ich mich nicht versagte. Kleine Arbeiten zur Stadt- und Kirchengeschichte kamen dann auch in den Heimatkalender. Kurzum, Anklam war eine Zeit, in der ich ohne Hetze Kenntnisse und Begabung einbringen konnte, so dass ich mit Dankbarkeit an diese Periode zurückdenke, zumal ich als Pastor weitgehend Dienst tat. So hab ich in Vakanzvertretung auf dem Land und in der Stadt bis 1984 mindestens 110 Gottesdienste halten können, was mir nur recht war, hatte ich mir im Stillen doch immer wieder einmal vorgeworfen, nicht bis zum 70. Lebensjahr durchgehalten zu haben.